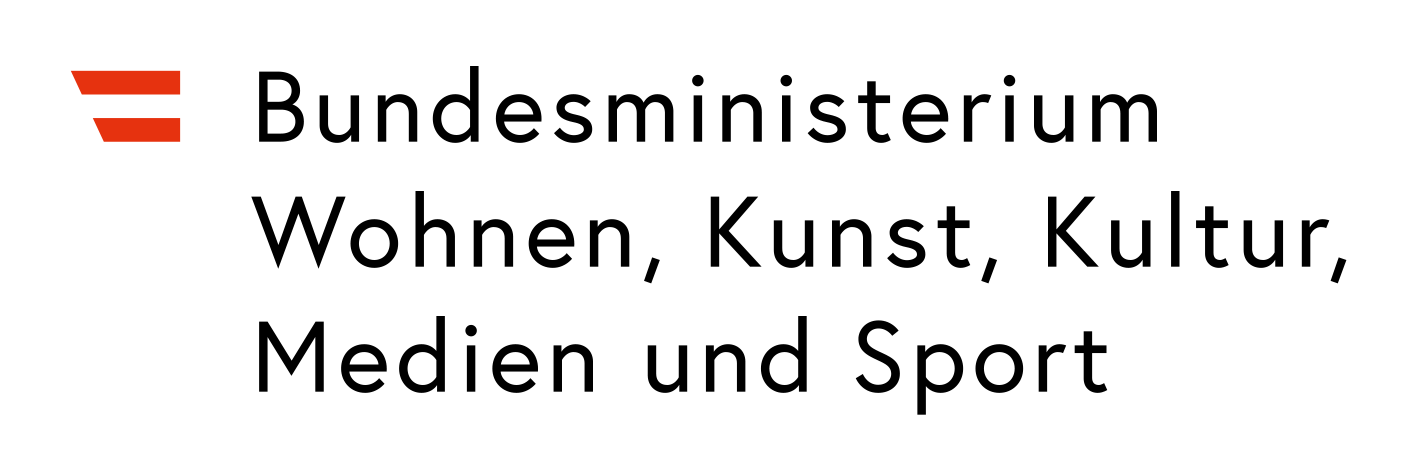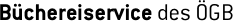Andrzej Stasiuk - Der Augenblicksverzauberer

Veröffentlicht am 11.06.2023
Robert Leiner über Andrzej Stasiuk.
Der polnische Romancier Andrzej Stasiuk unterscheidet zwei Arten von Schriftstellern: „Manche versuchen, die unstete, fliehende Wirklichkeit zu begreifen, manche glauben, es reiche, laut genug zu schreien, und schon bleibt die Wirklichkeit stehen und spitzt die Ohren.“ Schon die unterschwellige Ironie, mit der der zweite Typus porträtiert wird, verrät, dass es Stasiuk selbst eher mit den leiseren Verfahren hält, die in seinen Büchern in Form von Essays, Skizzen und Prosa vorgeführt werden. 2016 erhielt er den Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur.
Seine „lächerliche Autobiographie“ („Wie ich Schriftsteller wurde. Versuch einer intellektuellen Biographie“, 1998), so der polnische Schriftsteller Andrzej Stasiuk, habe ihn vor allem unter Freaks, Außenseitern und Musikleuten bekannt gemacht, die sonst überhaupt kein Buch anfassen. Er wäre lieber Rockstar geworden als Schriftsteller. Dass es anders kam, lag an der verwunschenen Trostlosigkeit Warschaus, dem Realismus Godots, der Musik der Sex Pistols und Leuten wie Lou Reed und Jean Genet. Und einer permanenten Rebellion gegen Eltern, Schule, Armee und Gesellschaft.
Der am 25. September 1960 in Warschau geborene Stasiuk wuchs in Grochów im Warschauer Stadtbezirk Praga-Południe auf. Nach eigenen Angaben wurde er, aufgrund von Abwesenheit und Desinteresse, vom Gymnasium, der technischen sowie der allgemeinen Berufsschule verwiesen. In seiner Jugend verbrachte er die Zeit lieber mit seinen Freunden, widmete sich aber auch ernsthaft dem Studieren unterschiedlichster Literatur, etwa von Allen Ginsberg und Dylan Thomas. 1979 wurde er zur Armee eingezogen und in der „4. Einheit Kołobrzeski Batalion Saperów“ in Debica bei Krakau eingesetzt. Dort hat es ihm gut gefallen: „Eine fantastische Einheit. Stell dir vor, sommerliche Übungseinsätze, braungebrannt wie Schwarze, mit mächtigen Bizepsen, haben im hüfttiefen Wasser Brücken gebaut und vierfache Portionen Essen verdrückt. Sowas bekommst du nicht in der zivilen Welt“. Doch er wurde nach Rzeszów versetzt.
Die Zustände dort beschreibt er als dumm und brutal, sodass er sich während eines Ausgangs, Silvester 1979/80 dazu entschloss, aus Gleichgültigkeit und Langeweile und nicht aus pazifistischer Überzeugung zu desertieren. Aus diesem Grund wurde er zu eineinhalb Jahren Militärgefängnis verurteilt, die er in einer speziellen Strafkompanie verbüßte, in der es seinen Darstellungen zufolge doppelt so schlimm zuging wie in der Armee in Rzeszów.
Mit seinen Mitinsassen entschloss er sich zu einem Aufstand, der darin bestand, das sie sich alle Haare am gesamten Körper abrasierten, in einen Hungerstreik traten und ihre sowieso funktionsuntüchtigen Maschinengewehre wegwarfen. Er kam fünf Monate in ein Untersuchungsgefängnis und schließlich in eine zivile Haftanstalt in Stettin, wo er dann den Rest seiner Strafe verbüßte. Nach seiner Entlassung wurde er als Held des Widerstands gefeiert. Doch er war weder Pazifist noch Dissident, er hatte einfach keine Lust mehr.
Er hielt sich mit einfachen Aushilfsarbeiten über Wasser, engagierte sich Mitte der 80er Jahre aber auch in der polnischen pazifistischen Oppositionsbewegung „Ruch Wolnosc i Pokój“ („Bewegung Freiheit und Frieden“). Für deren anarchistische Magazin-Reihe „Biblioteka A cappelli“ er auch Artikel schrieb. Sein Essay „Prison is hell“ (1988) etwa ist eine detaillierte und verstörende Schilderung der Zustände im Gefängnis, seiner Insassen und ihres Selbstverständnisses. Er beschreibt ausschweifender und durchaus poetisch die ideologische Bedeutung der Tattoos, die Hierarchie und Regeln innerhalb einer Gruppe und den sozialen Rang eines „Cwels“, der den untersten Platz in der Hierarchie des Gefängnisses einnimmt und für sexuelle Gefälligkeiten missbraucht wird. Dabei hinterfragt er die Intention des Systems nach Resozialisierung, indem er dieser die völlige Abschottung und Isolation der Insassen entgegenstellt. Als Lichtblick und größte Ablenkung unter den Gefangenen erwähnt er die gemeinsamen Erzählungen.
DIE MAUERN VON HEBRON
1985 verließ er dann Warschau und zog in das kleine Dorf Czarne in den Niederen Beskiden in Süd-Polen knapp an der Grenze zur Slowakei. Dort entstand in nur zwei Wochen sein erster Erzählungsband „Mury Hebronu“ (1992, „Die Mauern von Hebron“): „Aus Langweile kaufte ich mir ein Heft und einen Kugelschreiber, setzte mich eines Abends hin und schrieb, wie mir Opa Jarema geraten hatte, ein Buch über das Gefängnis. Zwei Wochen habe ich dafür gebraucht. So lange wie die Arbeit in der Zuckerfabrik. Ich hatte keine Ahnung, dass es so leicht ist, ein Buch zu schreiben.“ Eigenen Angaben zufolge hat er dabei kein Geld verdient und sein Freund, der das Buch mit seinem Verlag herausgegeben hatte, ging bankrott. Wieder griff er auch hier auf die Erlebnisse während seines Gefängnisaufenthaltes zurück und schilderte die ungeschönte und ungehörte Realität der Gefängnisinsassen. Mittels seiner Sprache verwandelt er den Alltag des Gefängnislebens zur existenziellen Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich.
In seinem Roman „Biały Kruk“ (1995, „Der weiße Rabe“) setzt Andrzej Stasiuk diesen charakteristischen Schreibstil fort, lässt sich aber auch von seiner Heimat, den Niederen Beskiden und der dortigen Landschaft inspirieren. Der Roman handelt von fünf, mittlerweile erwachsenen Jugendfreunden aus dem postkommunistischen Warschau, die gelangweilt aus ihrem monotonen und desillusionierten Alltag ausbrechen, um Abenteuer zu erleben und den wahren Sinn des Lebens zu suchen. Dabei hat jeder der jungen Männer eine eigene Vorstellung der Reise, die sie, gepflastert durch unzählige Wodka-Flaschen und Zigaretten, in die Heimat des Autors führt.
Der Leser begleitet die Protagonisten durch die kalten und schneebedeckten Landschaften der Niederen Beskiden, wird aber auch Zeuge nostalgischer und sentimentaler Erinnerungen an die Kindheit und Jugend im kommunistischen Warschau, wobei man sich fragt, ob das die Gedanken der Freunde oder die des Autors sind. Stasiuk wendet dabei eine männliche und teilweise vulgäre Sprache an und lässt die Ideale aus der Jugend der Männer mit der heutigen Realität konfrontieren.
Der Film „Gnoje“ (1995) von dem Regisseur Jerzy Zalewski basierte auf diesem Buch und Stasiuk übernahm eine kurze Statistenrolle. Im gleichen Jahr veröffentlichte er den Erzählband „Opowiesci galicyjskie“ („Galizische Geschichten“), welches der Regisseur Dariusz Jabłonski, 2008 unter dem Titel „Wino truskawkowe“ („Erdbeerwein“), verfilmte. Es besteht aus 15 Kurzgeschichten und Erzählungen, die das Leben der Bewohner einer Gegend um Südostpolen beschreiben.
DIE WELT HINTER DUKLA
Die Einflüsse der Niederen Beskiden werden auch in „Dukla“ (1997, „Die Welt hinter Dukla“), deutlich, wie zuvor schon in „Biały Kruk“. Das Buch ist nach einer nahe gelegenen Kleinstadt benannt und brachte ihm auch hierzulande Beachtung ein. Der polnische Karpatenort Dukla ist der Held dieses Buches. Der Erzähler besucht diesen weltverlorenen Ort immer wieder, beschreibt sein Licht, den Himmel, die alten Frauen in ihren Kittelschürzen, die Kinder, die Hunde, den Zerfall, die Leere und ein paar alte Škoda 105 auf dem Marktplatz. Er ist fasziniert von den Zwiebelschichten der Zeit, die hier im Zerfall sichtbar werden, und glaubt durch die Ritzen dieser kleinen Welt „ein paar Blicke in die Ewigkeit werfen“ zu können. Es ist ein Buch, das hauptsächlich aus Beschreibungen besteht. Der Erzähler warnt den Leser auch schon im dritten Satz, dass „die Erzählung keine Handlung hat“. Es ist die Beschreibung eines inneren Mikrokosmos‘, den viele in sich tragen, ohne davon zu ahnen. Die Stimmung der verschlafenen Kleinstadt spiegelt die Abwesenheit eines Helden der Geschichte wider, einer Geschichte, die im klassischen Sinne keine ist, denn „Die Welt hinter Dukla“ ist eben der Versuch, eine Geschichte ohne Handlung zu erzählen. Durch die Gegenüberstellung von Vulgarität und Prosapoesie, Distanz und Subjektivität taucht man, ohne es zu bemerken, in den Rhythmus der Erzählung ein. Von der magischen Anziehungskraft der Kleinstadt namens Dukla getrieben, übernimmt der Erzähler (ähnlich wie Andrej Tarkowskij in „Stalker“) gleichsam eine poetische Expedition in die eigene Seele und fordert zu einer Abrechnung mit der Vergangenheit heraus.
In seinem autobiographischen Bericht „Jak zostałem pisarzem“ (1998, „Wie ich Schriftsteller wurde“) schildert er die Entwicklung eines Daseinsanarchos, der weniger Einblick in das Werden eines Dichters, sondern mit seltener Prägnanz das volksrepublikanische Leben im Allgemeinen und den Rock‘n‘ Roll im Besonderen in den so ereignisreichen Jahren zwischen 1976 und 1986 in Polen schildert. Vorgetragen wird das in einer grandiosen Suada, die in nur zwölf Tagen geschrieben wurde. Diesen Rausch spürt man von der ersten bis zur letzten Zeile. Stasiuk und seinesgleichen lebten eine Mischung aus Hippie- und Punkkultur. Sie kifften, lasen die einschlägigen Kultautoren wie Castañeda, später Ginsberg, Lowry und Jerofejew. Einige, wie sein Freund Krosbi, fühlten sich von esoterischen Gurus aus Indien, später von dem tibetischen Buddhismus predigenden Dänen Ole Nydahl angezogen. Am wichtigsten jedoch war die Musik: Dead Kennedys, Talking Heads, Velvet Underground und die polnische Punkband Dezerter. Stasiuk wäre gerne Musiker geworden, viele Jahre konnte er sich nicht zwischen Schriftstellerei und Musik entscheiden. Sein ständiges Hin- und Hergerissensein zwischen „Rock‘n‘Roll und Literatur, Trinken und Nichttrinken, Klassik und Romantik“ und vielem anderen mehr, hat er selbst mit der Formulierung „ewiger Amateur“ am besten umschrieben. Seine lakonischen Zuspitzungen lassen den ironisch beschriebenen Lebenskampf humorvoll, konspirativ, gleichsam als nebensächlich erscheinen. „Nur scheinbar führten wir ein Leben ohne Prinzipien“, schreibt er.
1999 heiratete er die Kulturanthropologin Monika Sznajderman, mit der er eine Tochter namens Antonina hat, die 1990 geboren wurde. 1996 gründeten sie gemeinsam den Verlag „Czarne“, eine Hommage an ihren neuen Heimatort, zugleich aber auch das polnische Wort für „Schwarz“. Der Verlag konzentriert sich vor allem auf Bücher von mittelosteuropäischen Schriftstellern.
UNTERWEGS NACH BABADOG
In seiner 2004 herausgebrachten Sammlung von Reiseberichten durch das südliche Osteuropa, „Jadac do Babadag“ („Unterwegs nach Babadag“), versammelte Stasiuk 14 Reisebeschreibungen durch die Slowakei, Ungarn, Rumänien, die Republik Moldau, die Ukraine und Albanien, die er selber bereiste. Dabei nimmt er nicht die Position eines Touristen ein, sondern die eines Beobachters und beschreibt gewöhnliche Orte mit einem überaus liebevollen, aber doch auch scharfen und unverfälschten Blick.
Diese Texte sind bildkräftig wie Dokumentarfilme, detailscharf wie alte Schwarzweißfotografien und nicht selten bewusstseinserweiternd wie jene Kinokunstwerke, bei denen Reales und Surreales ineinander fließen (zu Recht erwähnt der Klappentext die Namen Buñuel und Fellini). Es geht ihm um das Bewahren und Archivieren einer versinkenden Welt, die in den Kriegen des 20. Jahrhunderts und während des kommunistischen Zwangsexperiments schwere Schäden davongetragen hat, jedoch erst jetzt, mit dem unaufhaltsamen Vorrücken des kapitalistischen Westens und der gedächtnisfeindlichen Gleichmacherei, vom Untergang bedroht ist.
In jener Welt mischen sich Restbestände alteuropäischer Milieus und Lebensformen mit den Provisorien, die beim Zusammenprall von schläfrigem Chaos und hektischer Neuzeit entstanden sind. Unberührte Landschaften stoßen an Industrieruinen und ökologische Wüsten, Dorfidyllen wie aus dem Märchenbuch existieren neben Schrotthalden und Kriegsnarben, intakter Provinzalltag mit Kleinbahnen, Gemüsegärten und Gemischtwarenläden behauptet sich inmitten von Vernachlässigung und Verfall. Diese „Epochenverschleppung” verbindet sich mit den Relikten eines fehlgeleiteten Fortschritts, mit einer Grundskepsis gegenüber allen neueren Verheißungen sowie einer Kunst der Improvisation, wie so oft in Randzonen der Zivilisation. Der titelgebende Ort Babadag ist übrigens einer der Orte, die Stasiuk zwischen Ostsee und Schwarzem Meer durchreist. Einer dieser „schwachen Orte“, die „verschwinden, sobald man sich abwendet“. Die Angst, sie und ihre Bewohner könnten aufhören zu sein, wenn er sie nicht beschreibt, sie könnten mit ihm und seinem erlöschenden Blick untergehen, treibe ihn an, so Stasiuk.
Der 2007 erschienene Essay „Dojczland“ nimmt wieder die Perspektive eines Reisenden ein und beschreibt diesmal die Lesereise eines polnischen Schriftstellers durch Deutschland, der diese Reise nur mit Alkohol ertragen kann und sich dem Kontakt zu den Einheimischen, außer seinen Lesern, verweigert.
„Taksim“ (2009, „Hinter der Blechwand“) ist nicht zufällig eine road novel. Schließlich ahmt für Stasiuk die Literatur „die Geografie nach“ und setzt sich „aus Blicken aus dem Auto“ zusammen. Und so besteht der Roman vor allem aus Bewusstseinssplittern und traumhaft erfassten Landschaften, wenn Wladek und Pawel mit ihrem alten Lieferwagen die Märkte und Basare Südosteuropas abklappern. Die beiden Männer nehmen Kurs auf die Karpaten und in das Vierländereck zwischen der Slowakei, Ungarn, Rumänien und der Ukraine. Es ist eine zivilisationsarme Grauzone aus Monokulturen, verlassenen Geisterstädten und staubigen Ebenen. Bis vor kurzem sind sie ihre Second-Hand-Klamotten aus dem Westen ohne Probleme losgeworden. Doch nun tauchen zwischen Blech, Beton und schmutzigen Glasscheiben farbenfrohe Häuserblocks auf: malerische Hieroglyphen preisen Textilien aus China zu Dumpingpreisen an. Als Wladek sich in die Kartenverkäuferin eines slowakischen Wanderrummels verliebt, werden die beiden Freunde unversehens in das kriminelle Treiben von Menschenschmugglern hineingezogen. Stasiuk bedient auch in diesem Buch das Klischee vom wilden Osten, in dem Menschenhandel und illegale Mülltransporte an der Tagesordnung sind.
In dem kleinen, schönen Büchlein „Grochów“ (2012, „Kurzes Buch über das Sterben“) erzählt Andrzej Stasiuk vier Geschichten über Abschied und Tod. Die Geschichten beschäftigen sich mit Verlust, mit Vergangenheit, mit den Grenzen der körperlichen Existenz. Die erste ist der Großmutter gewidmet, einer Bäuerin, die an Geister nicht nur glaubte, sondern völlig selbstverständlich mit dem Jenseitigen umging: „Die lebendige, übernatürliche Wirklichkeit, die wunderbar, aber vor allem schrecklich war, war Teil ihres Lebens“. Es folgen zwei Geschichten, von der langen Krankheit eines Freundes und Nachbarn („Augustyn“) und vom mühsamen Sterben eines alten Hundes. Letztere mündet in intensives Nachdenken über den allzu verständlichen Wunsch, jedes als unnötig empfundene Leid abzukürzen. Bei einem Tier gibt es da keine ethische Grenze. „Eine Spritze und fertig. Ich könnte es sogar selbst machen“, schreibt Stasiuk. Aber er tut es nicht, denn das Leben soll, so elend es auch aussieht, und so belastend es auch ist, bis zu seinem Ende dauern.
Das eigentliche Kernstück dieses Buchs vom Sterben ist der Abschied von Olek, dem Jugendfreund aus Grochów. Dort, in einer Arbeitervorstadt im Osten von Warschau sind sie aufgewachsen, hier haben sie in der Fabrik gearbeitet, von hier sind sie geflohen, immer wieder auf ziellose Reisen, und letztlich ganz. Auf einer solchen Reise sagt ihm Olek, dass er Krebs hat und nicht mehr lange leben wird. Sie sprechen nicht weiter darüber, und das Schuldgefühl, geschwiegen und den Freund allein gelassen zu haben, zieht sich durch den ganzen Text. Es ist ein trost- und illusionloser Text, eine überaus dichte Erinnerungsprosa, die auf der Suche nach der eigenen Substanz vor allem Fragen formuliert: „Sterben wir, kaum verändert? Kaum angebrochen? Weil wir keinen Unterschied zwischen uns damals und uns jetzt finden können?“
DER OSTEN
„Wschód“ (2015, „Der Osten“) ist so etwas wie eine Summe seines Reisens und Schreibens, niedergelegt in einem epischen Strom, hinreißend erzählten Episoden und Epiphanien. Er reist von Polen über Russland bis nach China und blickt auf sein Leben, das Gewirr aus Wegen und Routen, in dem ein Kindertraum sich mit dem Glücksgefühl kreuzt, das er in der Wüste Gobi empfindet. Immer wieder stellt er während des Unterwegsseins Vergleiche zu früher an, setzt die neuen Eindrücke mit katholisch gefärbten Kindheitserinnerungen in Beziehung. Den „Ramsch“ der „Chinamärkte“ in Polen verachtet der aus China Zurückgekehrte nicht mehr. „Ich betrete sie wie Zeitvehikel, die mich in die Zukunft des Planeten bringen. Oder in die Vergangenheit, in meine Kindheit.“ Besonders berührend: An einem Karsamstag ist er mit dem Auto in der Nähe von Lublin unterwegs. Während der Fahrt erinnert er sich an seine Mutter, seine Kindheit, die Momente im Flur vor dem Spiegel, bevor sie damals zur heiligen Messe gingen.
Was ist das, der Osten, dieses „Reich der Wunder“, das ihn immer wieder magisch anzieht, fragt er sich. Dieses Kontinuum, dessen Erschütterungen von Kamtschatka bis an die Elbe zu spüren sind. Ostpolen, die Heimat, aus der seine Eltern vertrieben wurden? Der Osten namens Sowjetkommunismus, dessen Präsenz die Gesellschaft, in der er aufwuchs, kontaminiert hatte? Osten, so könnte eine Quintessenz des Buches lauten, ist keine Himmelsrichtung, sondern die Verheißung einer Dimension jenseits der vom Grauen der Vergangenheit unterminierten europäischen Landschaften. Mit „Der Osten“ legte Andrzej Stasiuk weder einen klassischen Roman noch einen stringenten Reisebericht vor. Es ist ein Buch mit vielen persönlichen Schilderungen und Bewegungen, die den Leser geheimnisvoll durch Raum und Zeit führen. Es ist ein stark und wuchtig fließender assoziativer Monolog aus Beobachtung und Bekenntnis, Erinnerung und Hommage, Reflexion und Vision. Man kann sich im Labyrinth dieser Annäherungen an die Metapher des Ostens mitunter verlaufen und bleibt doch getragen von der Poesie der Sprache und der Kraft einer Anschauung, der Ironie und Heiterkeit nicht abgehen.
In „Kroniki beskidzkie i swiatowe“ (2018, „Beskiden-Chronik“) richtet Stasiuk seinen Blick wieder auf die nähere Umgebung, das heimatliche Polen, hier und heute. Ein Land, das sich auf eine ungeahnte Weise verändert. Ausgehend von seinem Dorf in den Beskiden, einer Bergregion an der Grenze zur Slowakei, nimmt er die Gegenwart in Augenschein. Der Band versammelt unterschiedliche Feuilletons und poetische Miniaturen, die er zwischen 2013 und 2018 geschrieben hat. Das Buch versammelt „Nachrichten aus Polen und der Welt“ und besticht durch Neugier auf die Wirklichkeit. Statt den polnischen Autoritarismus direkt zu kritisieren, beschreibt er lieber Alltag und Sorgen in der Provinz. Und manchmal entzieht er sich dem Auftrag seines Redakteurs und verschreibt sich dem Reisen, etwa nach Russland, Kasachstan, Kirgisien und Tadschikistan, oder der Natur, den Schafen, dem Wind. Alle Stücke leben wieder vom Zauber des Unterwegsseins. Man reist mit ihm durch die Jahrhunderte, über die Dörfer, über Landesgrenzen hinweg, und überwindet dabei auch immer wieder Klischeevorstellungen. Und immer wieder kommt der Punkt, an dem Stasiuk wieder im Konkreten, in der Gegenwart ankommt, als ein wahrhafter Augenblicksverzauberer.
GRENZFAHRT
Während der polnische Begriff „Przewóz“ (so der Titel seines letzten Romans aus dem Jahr 2021) verschiedene Lesarten zulässt wie Beförderung, Transfer, Transport und im übertragenen Sinn Anlegestelle, gibt der Titel der deutschen Übersetzung „Grenzfahrt“ mehr preis, interpretiert bereits, was einen thematischen Schwerpunkt ausmacht: die Flucht eines jüdischen Geschwisterpaars von der polnischen Seite unter deutscher Besatzung über einen trügerischen Fluss ans andere Ufer unter sowjetischer Kontrolle, was (wenn überhaupt) nur mit einem waghalsigen Fährmann möglich ist. Die jungen Leute, viel zu spät dran für ihr Traumziel Birobidschan, sind zwischen zwei feindlichen Armeen gestrandet. Der Hitler-Stalin-Pakt steht im Juni 1941 kurz vor seinem Kollaps. Die Chance, dem im Juni bevorstehenden Inferno zu entgehen, ist gering. Nicht nur für jüdische Flüchtlinge, sondern auch für die Partisanen, die die Deutschen aus patriotischen Gründen hassen – und die Juden dank des "christlichen" Hasses, der schon mit der Muttermilch eingeflößt wurde. Nicht zu vergessen die lokalen Kleinbauern, deren Armut man sehen und riechen kann.
Stasiuk beschreibt die polnische Sommerlandschaft am Bug, so der Name des ungenannten Flusses, anschaulich wie ein Landschaftsmaler. Über den Bug wollen die jüdischen Geschwister ans Ufer unter sowjetischer Kontrolle flüchten.
Eine Gewaltorgie erreicht ihren Höhepunkt in der Beschreibung der Schlachtung eines um sein Leben kämpfenden Schweins sowie in Tortur und Ermordung eines vermeintlichen Spitzels durch die Partisanen. Selbst der Fluss ist voller Tod, denn in ihm treiben viele namenlose Leichen flussabwärts. Niemand nimmt Anteil, man verroht und achtet, wenn möglich, nur darauf, nicht selbst Opfer zu werden. Und ein kleiner Junge sieht und hört und erinnert sich an all das, eine eiserne Schlange aus Panzern, Lastwagen, Maschinen, den Donner herannahender Flugzeuge, das Beben der Erde. Jahre später versucht der Erzähler eine Geschichte zu erzählen, die sein Vater nach der Rückkehr aus dem Krieg ihm nicht erzählt hat. Ein Trost ist: der Bug „wird immer da sein“, „ein wilder, ein anmaßender Fluss. Er tat, was er wollte. Er floss über, strich ein, ertränkte, um sich dann in sein Hauptbett zurückzuziehen.“ Er ist die eigentliche Hauptfigur in diesem Roman und die Schilderungen, die Stasiuk versucht, sind überaus elegant und poetisch.
Wenn er an seine Kindheit zurückdenke, so Andrzej Stasiuk in einem Interview, „wird mir klar, dass mich nicht so sehr das Leben in der Stadt prägte, sondern die Zeit, die ich bei den Großeltern auf dem Lande verbrachte. Das war meine stärkste, intensivste Kindheitserfahrung. Aber es stimmt, die Großmutter war am wichtigsten. Sie konnte wirklich fabelhaft erzählen. In dem Dorf, in dem sie lebte, gab es in den 60er Jahren noch keinen Strom, wenn die Nachbarn also zusammenkamen, wurde viel erzählt. Und in den Geschichten meiner Oma vermischte sich die Welt der Menschen mit dem Reich der Geister. Dass zum Beispiel der Geist ihres Vaters sich kurz in ihrer Küche zu schaffen machte und dann wieder verschwand, war für sie das Natürlichste in der Welt. Trotz ihrer Religiosität hatte sie damit nicht das geringste Problem. Ich begann selbst auch, an die Geister zu glauben. Als sie starb, war es nicht ihr Tod, der mich erschreckte, sondern die schwarze Fahne mit einem Kreuz, die über der Schwelle ihres Hauses wehte.“
Und auf die darauffolgende Frage, ob er diesen Glauben immer noch kultiviere, meinte er: „Ja, das tue ich. Wissen Sie, ich bin ein Slawe und damit ein Heide, denn wir sind in Wirklichkeit sehr schwach christianisiert (lacht). Außerdem kam das Christentum zu uns aus Deutschland, und ich muss etwas Eigenes, meinen eigenen, unverfälschten Hintergrund haben. Und zu dem gehört der Glaube an die Geister und vor allem an die Ahnen. Ich kultiviere ihn, der Modernität, ja sogar der Postmodernität zum Trotz. Denn das ist meine Identität – egal, ob sie echt ist oder imaginär.“das ist meine Identität – egal, ob sie echt ist oder imaginär.“
Foto: (c) CaiCaslavinieri / Suhrkamp Verlag