Anne Weber - Träume sind zäh
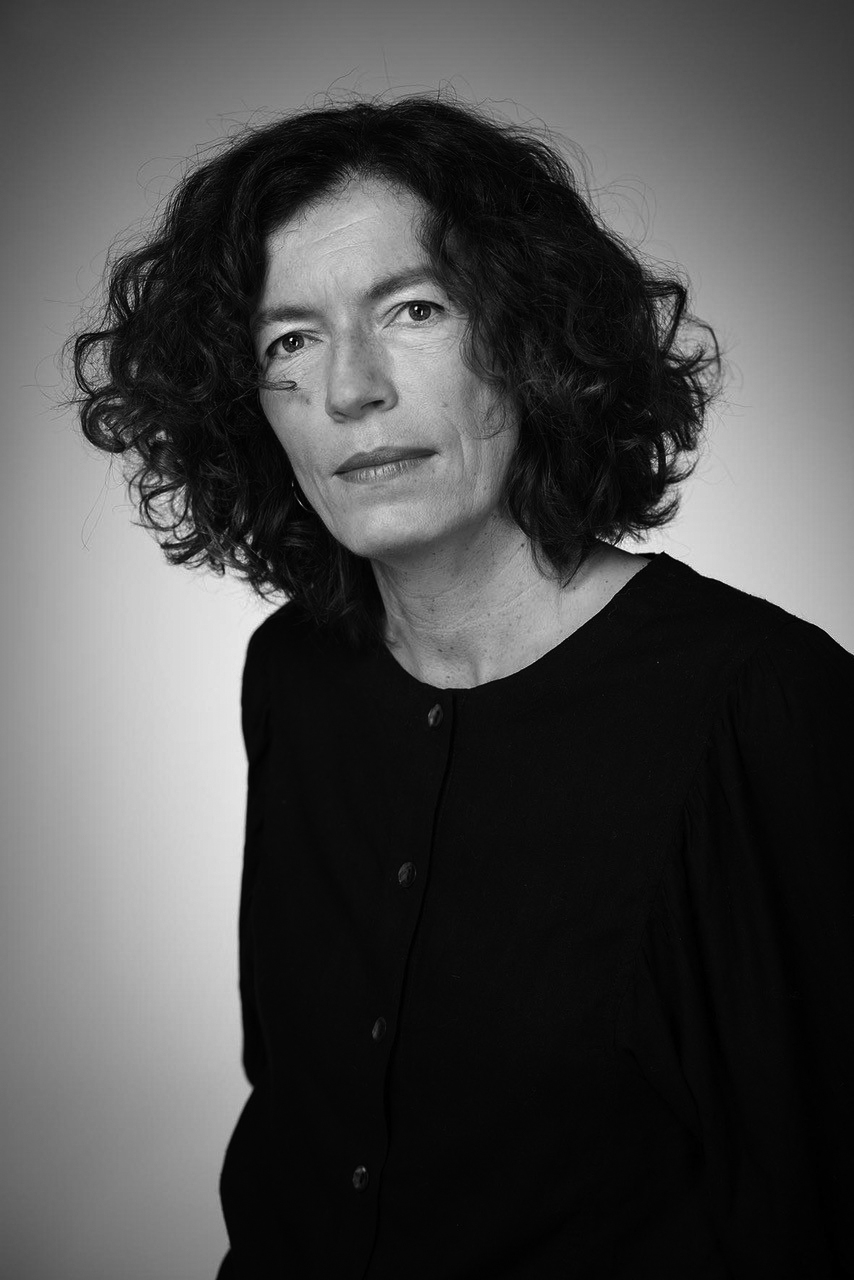
Veröffentlicht am 14.11.2020
Robert Leiner über Anne Weber, die den Deutschen Buchpreis 2020 erhielt
Die Fragestellerin in Anne Webers erstem Buch heißt Ida und ist ein skeptisches Wesen mit einer tiefen Freude an der genauen Beobachtung und am unerbittlichen Nachbohren. In den über fünfzig Kurz- und Kürzestgeschichten unter dem Titel „Ida erfindet das Schießpulver“ (1999) lernt man eine kleine Anarchistin kennen, die gerne auf Seifenblasen reist, einen Frosch im Hirn hat und die Menschen glücklich machen will. Sie erinnert durchaus an Lucy von den Peanuts, mit ihrem weiblichen Selbsthass, ihrem leicht asozialen Verhalten und ihrer Besserwisserei. Am liebsten würde sie den Planeten sprengen, doch zuvor „zerfällt sie regelmäßig in ihre Einzelteile“ und hadert mit den üblichen menschlichen Verfallserscheinungen wie Gedächtnisverlust und Depression. Zum Glück kann sie, diese wahrhaftig bezaubernde Denkfigur, bei Bedarf schnell die Köpfe wechseln.
Allen Büchern von Anne Weber eignet eine Neigung zur logischen Konsequenz, die das scheinbar Normalste der Welt mit unschuldigem Blick von allen Seiten betrachtet, um feststellen zu müssen, dass das Normale im Grunde völlig abwegig und grotesk ist. Es müsste, Anne Weber zufolge, noch nicht einmal wahr sein, aber doch zumindest plausibel.
Anne Weber wurde 1964 in Offenbach geboren und ging im Alter von 19 Jahren nach Paris, um an der Sorbonne französische Literatur und Komparatistik zu studieren. Von 1989 bis 1996 arbeitete sie in Lektoraten verschiedener französischer Verlage. Und sie übersetzte deutschsprachige AutorInnen wie Wilhelm Genazino, Peter Handke, Sibylle Lewitscharoff, Erich Maria Remarque, Lea Singer ins Französische – und französische AutorInnen wie Julia Deck, Marguerite Duras, Pierre Michon, Georges Perros und Cécile Wajsbrot ins Deutsche. Auch ihre eigenen Texte schreibt sie zuerst auf Französisch und übersetzt sie dann ins Deutsche.
Derart respektlos wie in den kurzen Texten ihres Debütbands „Ida erfindet das Schießpulver“ (1999) betrachtet sie in ihrem zweiten Prosabuch „Im Anfang war“ (2000) dann gleich die göttliche Schöpfungsgeschichte. Die häufig blutigen und überaus exzessiven Geschichten der Bibel, dem Buch der Bücher, nimmt sie in ihrer keineswegs frivolen oder gotteslästerlichen Exegese nur sehr wörtlich und denkt sie schlüssig zu Ende. Moses als Extrembergsteiger, Esther als erste Miss Persien, der Beginn der Psychoanalyse mit Josephs Traumdeutungen und die Sintflut als erster geplanter Völkermord der Geschichte. Anne Weber nimmt in ihrem Buch all diese Mysterien auf heitere Weise ernst und zeigt, dass zwar der Schöpfungsgedanke vollkommen war, die Menschen jedoch nicht.
Auch in „Erste Person“ (2003) folgt sie der Diktion, die Dinge nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. Es geht um die nackte Existenz in all ihren Klammheiten, vom Nullpunkt, also vom Ich aus gedacht: „Alle Personen sind erste Personen. Das erschwert das Leben in einer Gesellschaft erheblich.“ In dieser (selbst)reflexiven Prosa, die mit einer Herausgeberfiktion spielt, kreisen die Gedanken und Monologe um die Grundfesten des Lebens: Angst in allen Variationen, der von Gott verlassene Mensch und die Liebe als Illusion für eine käufliche Viertelstunde. Wichtig erscheint dabei, dass diese Prosa ihre „spröde Grazie einer kunstvoll ziselierenden Sprach- und Denkarbeit verdankt“ (so Hermann Kurzke).
In „Besuch bei Zerberus“ (2004) bleibt die Reisende, die hier von sich erzählt, in Cerbère – Zerberus –, der kleinen Vorhölle. Ist der Hölleneingang auf der Karte Frankreichs eingezeichnet? Wer sich auf den Weg nach Süden macht, die Küstenstraße am Mittelmeer entlangfährt bis nach Spanien hinein, kommt nach Port Bou, an einen Ort, der für den Übergang zwischen Leben und Tod, zwischen Lebenwollen und Aufgeben, zwischen Flucht nach vorne und endgültigem Innehalten steht. In dieser Küstenstadt erreicht sie eine Nachricht: Der Vater, der bis dahin wie unantastbar, körperlos und somit unsterblich erschien, ist lebensgefährlich erkrankt. Der erinnerten Kindheit entsteigt die Welt des immer schon abwesenden Vaters als eine ersehnte, unerreichbare, zu der man nur hochschauen, aber in die man nicht vordringen kann. Der Vater, der bis dahin wie unantastbar, körperlos und somit unsterblich erschien, ist lebensgefährlich erkrankt. Der erinnerten Kindheit entsteigt die Welt des immer schon abwesenden Vaters als eine ersehnte, unerreichbare, zu der man nur hochschauen, aber in die man nicht vordringen kann. Gegen die Welt der großen Geister den eigenen Kosmos zu schaffen und zu behaupten ist eine Aufgabe, der sich die Erwachsene stellen muss und endlich stellen will. So leichtfüßig tastend wie zielstrebig, so scharfsinnig wie poetisch begibt sich Anne Weber auf eine faszinierende Reise.
In „Gold im Mund“ (2005), ihren nächsten Prosaband, hat sie ihre Erzählerin in ein Schweizer Großraumbüro versetzt: feste Arbeitszeiten, ein Schreibtisch in der Dentalabteilung von ‚Cendres & Métaux‘, telefonierende Kollegen, klappernde Tastaturen, ein Durcheinander von Stimmen und Bürogeräuschen, ein idealer Ort zum Schreiben Hier jedenfalls verwandelt sich die Arbeitswelt in ein Refugium, in dem das Beobachten genauso anregend wird wie das wild schweifende Assoziieren. Eine Schreibtischlampe, eine Zimmerpflanze, die Zahnmodelle und Spezialgeräte der Firma und der Blick aus dem Fenster bergen Geheimnisse, die die Phantasie anregen. Die Erzählerin erlaubt sich schräg in die herrschende Diktion hineinragende Gedanken über das Ende des Kapitalismus, die Naturgesetze oder den abwesenden Direktor und stellt scheinbar naive Fragen zu den ökonomischen Verhältnissen. Sich dem Angestelltendasein so leichtfüßig zu nähern, gelingt, weil die Erzählerin das Privileg genießt, sich freiwillig und unabhängig im Büro zu bewegen. Das Gegenbild zu diesem entspannten Ausflug in den Werktag zeichnet der Brief an die ‚lieben Bürovögel‘: Geschrieben aus der Perspektive einer des erwerbstätigen Eingezwängtseins Müden, liest er sich als eine wütende Tirade, ein Befreiungsschlag, die furiose Verabschiedung von der Angestelltenexistenz.
Samuel Moser beschrieb in der NZZ „Gold im Mund“ als ein „Stück Literatur aus der Arbeitswelt“, genauer „aus der Arbeitswelt des Dichters“. „Gold im Mund“ proklamiere das Recht des Dichters auf den falschen Platz und das Recht des Textes auf Zusammenhangslosigkeit. Beeindruckt ist Moser von Webers Sätzen, die „oft verträumt zum Fenster hinaus entschweben“, und Gedanken, die „sich in Spekulationen verflüchtigen“. Er attestiert der Autorin, nach ihren „bohrenden, an die Grenze der Selbstzerstörung gehenden“ beiden vergangenen Büchern im vorliegenden Band eine Gelassenheit, die tatsächlich ein Wunder sei, selbst wenn es sich um eine „rein poetologische Gelassenheit“ handle, wie sie wenig später feststellt.
„Luft und Liebe“ (2010) ist eine mitreißende Liebes- und Verratsgeschichte, ein großes literarisches Vergnügen. Die große Liebe – gibt es das Anfang Vierzig? In Herzensdingen längst an das ganz normale Glück oder Unglück gewöhnt, begegnet sie in Paris einem nicht mehr ganz jungen Mann mit Bauchansatz, nach dem sich auf der Straße niemand umdrehen würde. Aber entgegen allen Erwartungen ist er der Mann, auf den sie gewartet hat: Er ist zärtlich, aufmerksam und charmant, Hals über Kopf verliebt und verspricht er ihr den Himmel auf Erden. Und um die Idylle vollkommen zu machen, lebt dieser Märchenprinz dann auch auf einem Schloss in der französischen Provinz. Zu schön, um wahr zu sein Als die Träume, ein gemeinsames Leben, Hochzeit, ein Kind, Realität werden sollen, zerplatzt alles wie Seifenblasen. Und die mit großer Leichtigkeit und funkelnder Ironie erzählte Geschichte nimmt ein Ende mit Schrecken. Anne Webers sprachliche Brillanz, ihre Fähigkeit, „auf leichte Art ernst zu werden“ machen aus dieser unerhörten Begebenheit einen außergewöhnlichen, beeindruckenden doppelbödigen Roman.
2011 veröffentlichte sie „August. Ein bürgerliches Puppentrauerspiel“. Anne Weber erzählt darin von der Existenz von August von Goethe, vom tragischen Schicksal eines Sohnes und seinem Kampf um Souveränität. Als Sohn eines berühmten Vaters, Sohn einer nicht standesgemäßen Mutter, entkommt August von Goethe den Familienschatten nicht, reibt sich auf und geht schließlich daran zugrunde: Ein blasser Junge, der den eigenen Weg, das eigene Leben nicht findet. Anne Weber wählte hier die Form eines Theaters im Kopf, um die Existenz eines ewigen Sohnes und sein Ringen um Selbständigkeit als Ausweg in die Freiheit literarisch vielstimmig und eindringlich darzustellen.
In „Tal der Herrlichkeiten“ (2012) erzählt sie die Geschichte einer Liebe, die wie ein wilder nächtlicher Traum den Leser durch den Tag begleiten wird. Ein Mann, eine Frau, Sperber und Luchs, ein Hafen in der Bretagne. Eine große Liebe bricht an, in ihrer Heftigkeit und Macht absolut neu, unerwartet. Zwei herrliche Tage und Nächte sind ihnen gegeben, dann werden die beiden Liebenden auseinandergerissen.
Wer nicht sucht, der findet: So geht es Sperber, der auf einem Kai in der Bretagne seiner großen Liebe begegnet. Als Sperber und Luchs auseinandergerissen werden, wird Sperber seiner Geliebten an einen Ort folgen, von dem es eigentlich keine Wiederkehr gibt, denn „die Liebe, Wunde und Heilung zugleich, verleiht Kräfte, über die der Mensch sonst nicht verfügt“. Anne Weber erzählt die Geschichte einer Liebe, die wie ein wilder nächtlicher Traum den Leser begleiten wird.
„Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch“ (2015) nennt Weber eine poetische Zeit- und Entdeckungsreise, auf die sie sich begibt und die in die befremdende und faszinierende Welt ihres Urgroßvaters und damit in die Abgründe und Höhenflüge einer ganzen Epoche führt. Florens Christian Rang (im Buch Sanderling genannt) war Jurist, Pfarrer in zwei Dörfern bei Posen, Schriftsteller und Philosoph. Er korrespondierte mit Hugo von Hofmannsthal, war befreundet mit Martin Buber und Walter Benjamin.
Auf der Reise zu diesem Urgroßvater stellt sich immer wieder ein gewaltiges Hindernis in den Weg: die deutsche und familiäre Vergangenheit, wie sie nach Sanderlings Tod weiterging. Und damit die Frage, wie es sich lebt mit einer Geschichte, die man nicht loswerden kann. Was bedeutete es vor hundert Jahren, deutsch zu sein? Und wie ist es heute? Es ist eine ebenso poetische wie reflektierte Zeitreise, die zugleich von den Sehnsüchten und dem Schmerz der Gegenwart erzählt. Gefragt nach ihrem Verhältnis zu Deutschland, bekannte Anne Weber vor Jahren einmal: „Ich stehe ein bisschen abseits und schaue immer mal wieder rüber.“ Letzteres deshalb, weil sie seit ihrem 18. Lebensjahr in Paris lebt und längst auf Französisch denkt und schreibt, wie sie gern betont. Und man rühmt nicht selten an ihren Büchern, dass sie „ohne deutsche Geschichtsbeschwernis“ auskämen.
Diese Beschwernis erwartet den Leser allerdings nun in diesem Buch. Darin geht es auch um die „Bürde“, Deutsche zu sein – eine latente Grundparanoia der Autorin, Jahrgang 1964, etwa bei Gesprächen mit jüdischen Freunden in Paris, als Deutsche letztlich doch als „Tochter eines Mörders“ gesehen zu werden.
Den Anlass für ihre poetisch-autobiografische Meditation über Herkunft und Identität bildet eben die Auseinandersetzung mit Leben und Werk ihres Urgroßvaters Florens Christian Rang. Dieser Vorfahre starb zwar bereits 1924. Einfacher wird die Annäherung an den heute vergessenen ketzerischen Theologen und Kulturphilosophen deshalb aber nicht, wie sich zeigt. Denn auch wenn Rang/Sanderling, nach einem Wort seines Freundes Walter Benjamin, der „tiefste Kritiker des Deutschtums seit Nietzsche“ war, so wurde doch aus seinem Sohn, dem Großvater der Autorin, ein „glühender Nazi“. „Wie hat es geschehen können, dass aus dem Sohn eines Sanderling, eines Mannes also, der von Juden umgeben war und in ihnen seine, des Christen ältere Brüder sah, ein Nazi wurde?“, fragt Anne Weber und sieht darin ein Problem, das weit über die eigene Familie reicht.
Doch wird ihr Biografieprojekt bald infrage gestellt, und zwar ausgerechnet von der Person, von der sie sich Antworten auf ihre Fragen erhofft: Ihr greiser Vater unterstellt ihr, sie wolle sich mit ihrem Buch ja nur „in die Familie einschreiben“. In jene Familie, die so lange nichts von ihr, der unehelichen Tochter, wissen wollte. Und nun also ein Buch ausgerechnet über ihren Urgroßvater? „Was denn bei alldem überhaupt herauskommen soll, will er wissen“.
Wer aber war dieser Florens Christian Rang? „Viele Eigenschaftsworte würden auf ihn passen“, konstatiert Anne Weber: „der Suchende, der Wahnsinnige, der Haltlose, der Radikale, der Unbändige, der Stürmische.“ 1864 in Kassel geboren, wurde Rang zunächst der Familientradition gemäß Verwaltungsbeamter, während er privat das Leben eines Bohemiens führte. Es folgten: eine überraschende Wende zu Gott, das Studium der protestantischen Theologie, seelisch schwere Jahre als Pastor im damals preußischen Posen, eine folgenreiche Nietzsche-Lektüre, schließlich eine radikale „Abrechnung“ mit dem Christentum. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs begrüßte Rang so begeistert wie die meisten Intellektuellen der Zeit, kurz zuvor wollte er noch an der Seite Martin Bubers, Gustav Landauers und Walther Rathenaus eine utopisch-geistesaristokratische Gemeinschaft mitbegründen, heute bekannt als „Forte-Kreis“. Nach dem Krieg war Rang mit Hofmannsthal, Gershom Scholem und Walter Benjamin befreundet, beschäftigte sich mit den Ursprüngen des Karnevals und rief dazu auf, sich mit den Kriegsgegnern auszusöhnen, indem die Deutschen freiwillig Wiedergutmachung leisteten.
Das alles erfährt man in Webers Buch, dem „Journal einer Erkundungsreise“, nur bruchstückhaft nach vielen Um- und Seitenwegen. Mal vor-, mal rückwärts bewegt sich ihre „Reise in die Fremde, zu meinen Vorfahren hin“, stets begleitet von Selbstzweifeln und Reflexionen, etwa über Scham und Schweigen in deutschen Familien. Begegnungen mit Freunden in Frankreich sind ebenso Etappen ihrer Erkundung wie der verstörende Leserbrief einer Psychiatrieinsassin oder Lektüren, darunter Werke von H. G. Adler, Susan Sontag oder Ernst von Salomon. Und natürlich auch Reisen, etwa zur psychiatrischen Klinik Hadamar, in der die Nazis tausende Patienten ermordeten. Mit einer Biografie im herkömmlichen Sinn hat dieses essayistische Prosawerk daher wenig zu tun, dafür viel mit der Frage: Wie ist biografisches Schreiben überhaupt möglich?
Zumal für eine Nachgeborene mit skrupulösem Sprachbewusstsein: „Wir sehen die Worte davonschwimmen. Keines von ihnen ist mehr einzuholen; kein Satz kann mehr so verstanden werden, wie er gemeint war, und nur so (…) man müsste die Zeit unvergangen machen können.“ Die Zeit zwischen ihr und ihrem Urgroßvater aber ist da, mal als eine „fensterlose Wand“, mal als ein „Riesengebirge; angehäuft aus Toten“: dem Holocaust als „Binde- und Trennungsglied“.
Und mal als eine Person, die zwar über Kleist, Kafka und Hesse schrieb – aber über deren braune Gesinnung doch kein Zweifel bestehen kann: ihr Großvater, der in der NS-Zeit als „ehrenamtlicher Kulturberichterstatter“ für den Sicherheitsdienst der SS tätig war. Lässt sich die „Zeitmauer“ überwinden, führt ein Pfad vom Urgroßvater zum Großvater? Vielleicht bis zu ihr? In Rangs Erinnerungen an seine Jahre als Pastor in Posen findet Weber eine Stelle, die ihr den Ahnen abgrundtief fremd werden lässt – die alle Befürchtungen zu bestätigen scheint. Als Rang irgendwann um 1900 eine „Irren- und Idiotenanstalt“ besucht, zieht er den Assistenzarzt zur Seite und fragt ihn: „Warum vergiften Sie diese Menschen nicht?“ Der Satz wird die Autorin verfolgen, ins hessische Hadamar ebenso wie später nach Polen. Wie aber Anne Weber den sich sogleich aufdrängenden Schlüssen bis zum Schluss misstraut, wie sie vorschnelle Urteile mit immer neuen Zweifeln und Fragen begegnet, das macht diese großartige Begegnung der Lebenden mit den Toten zu einem großen literarischen Lehrstück.
Der Protagonist ihres nächsten Romans „Kirio“ (2017) geht gerne auf den Händen und stellt auch sonst alles auf den Kopf. Er spielt Flöte und redet mit Steinen und Fledermäusen ebenso selbstverständlich wie mit Menschen. Er nimmt alles für bare Münze, bis auf die bare Münze selbst. Er vollbringt Wunder über Wunder und merkt es nicht. Wer also ist dieser Kirio? Und wem gehört die Stimme, die von ihm erzählt? Sie weiß es selber nicht! Wer ist Kirio? Ein seltsamer Vogel, ein Verrückter, ein Heiliger? Seine Spur findet sich zuerst in Südfrankreich und verliert sich im Hanau der Brüder Grimm. Und so ist das Rätsel auch dem Leser aufgegeben. Ist es die des Autors? Die des Schöpfers? Eines Engels? Der Phantasie? Anne Webers Roman liest sich wie eine moderne Heiligenlegende und zugleich als ein poetischer Grenzgang zwischen Himmel und Erde. Es ist tatsächlich ein Buch, das seinesgleichen sucht – und bis zum Schluss auch seinen Erzähler.
Für ihr hochgestimmtes, aber nicht illusionäres Buch vom Widerstand, „Annette, ein Heldinnenepos“ (2020), erhielt Anne Weber zu Recht den Deutschen Buchpreis als bester deutschsprachiger Roman des Jahres. Es ist in Versen erzählt, reimlosen und eher grafisch angedeuteten Versen, die aber den Leserhythmus beeinflussen, der einzelnen Zeile und Wendung mehr Wert und Klang geben und dem Text etwas Hehres. Dabei verzichtet Anne Weber nicht darauf, die ihr eigenen Späße und Lässigkeiten einzuarbeiten, hier ein „okay, okay“, dort die Erkenntnis: „oft hört sich das Ganze eigentlich ganz lustig an“, und das gilt für die Abenteuer der Heldin wie für das Epos selbst. Dass das Gewitzte das Aussprechen der Dinge erleichtert: nichts Neues, aber auch nichts Banales.
Es geht um die Französin Anne Beaumanoir, genannt Annette, Jahrgang 1923, in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt, in Deutschland wenig bekannt. Ihre zweibändige Autobiografie ist auch auf Deutsch erschienen (Edition Contra-Bass). Anne-Annette, lernen wir aber nun zuerst bei Anne Weber, wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Sie liest Arthur Koestler und bringt ihrer Großmutter die Anfänge des Schreibens bei. Als 19-Jährige schließt sie sich den Kommunisten und der Résistance an. Die Deutschen sind einmarschiert, auch wenn Annette nicht gerne sagt: „die Deutschen“. Es gibt solche und solche, weiß sie. Es gibt auch solche und solche Franzosen.
Anne Weber beschreibt, wie Heldentum, wie der Widerstand gegen das Böse entsteht. Man muss sich daran gewöhnen, denn „wie das meiste / ist auch das Widerstehen anders, als man es sich / denkt, nämlich kein einmaliger Entschluss, / kein klarer, sondern ein unmerklich langsames / Hineingeraten in etwas, wovon man / keine Ahnung hat. Das Erste, dem / zu widerstehen gilt, das ist man selbst. / Der eigenen Angst.“ Annette stellt sich aber schnell darauf ein. Schon geht es nicht mehr darum Plakate zu kleben oder Flugblätter unter die Leute zu bringen. Juden in einer Dachkammer brauchen ein neues Versteck. Annette beschämt einen wie jede echte Heldin, weil sie nicht zögert zu retten, wen sie retten kann. Anne Weber zeigt die ängstliche Frau mit dem Baby, den Mann mit den beiden Kindern. Der Mann schaut Annette an. „Er fragt sich wohl, wer dieses fremde Mädchen sei, / das aus dem Nichts auftaucht und ohne Grund / oder nur aus dem einen, dass sie ein Mensch ist / und sie auch Menschen, sie alle retten will.“ Parallelen zu Geflüchteten heute entgehen der Autorin nicht. Sie appelliert nicht, sie macht aufmerksam.
Annette kann nicht alle retten, aber die beiden Kinder. Sie werden wirklich gerettet und später für Annette aussagen, als es um einen anderen, aber verwandten Fall geht. Denn nach dem Krieg gibt es etwas in Annette, das unruhig wird („Ärztin, Neurophysiologin, Mutter von zwei / Söhnen wird Annette nebenbei“ und ist immer noch sehr jung). Sie will etwas tun. Was sucht sie? Was will sie sein? Was wäre ihr Traumberuf? „Abenteurer? Umstürzler? Barrikadenkämpfer? / Es kommen einem nur Berufe in den Sinn, die männlich und die / zudem gar keine Berufe sind.“ Durch einen Urlaub wird sie mit der Situation in Algerien konfrontiert. In der zweiten Hälfte des Buchs, aber immer noch in der ersten Hälfte ihres Lebens, engagiert sie sich für die Unabhängigkeitsbewegung, für die FLN. „Ist dieses Ziel es wert, sich dafür / aufzuopfern? Noch einmal antwortet Annette mit: Ja. / Einige Augen muss sie dabei schließen, das Auge / beispielsweise, das die zerfetzten Kinder sehen kann, / die bei Anschlägen in Bars und Tramways in Algier / und woanders sterben.“
Annette wird dadurch nicht zu einer gebrochenen Heldin. Sie ist nicht fanatisch, aber stabil, wie es sich für eine Heldin gehört. Aber Anne Weber oder die Erzählerin melden jene Zweifel an, die eine Heldin nicht hat, oder nur gelegentlich und kurz. „Träume sind zäh“, und obwohl sich Annette keine Illusionen macht, kann sie vieles in Kopf und Leben unterbringen. Die Erzählerin kommentiert also manches. Sie schreibt und weint auch um die Verlorenen, den seinerseits weinenden Vater, der sich von seinen Kindern getrennt hat, um wenigstens sie zu retten. Und sie tritt nachher als „große, ernste Deutsche“ selbst aus den Kulissen und lernt die erzählende Annette kennen. Trotzdem bleibt sie inkognito, wie es sich im Mittelalter für ein Epos gehört hätte, das ja kein Roman ist. Aber was für ein Leben! Und was für ein großartiges Buch!
Foto: (c) ÖNB






