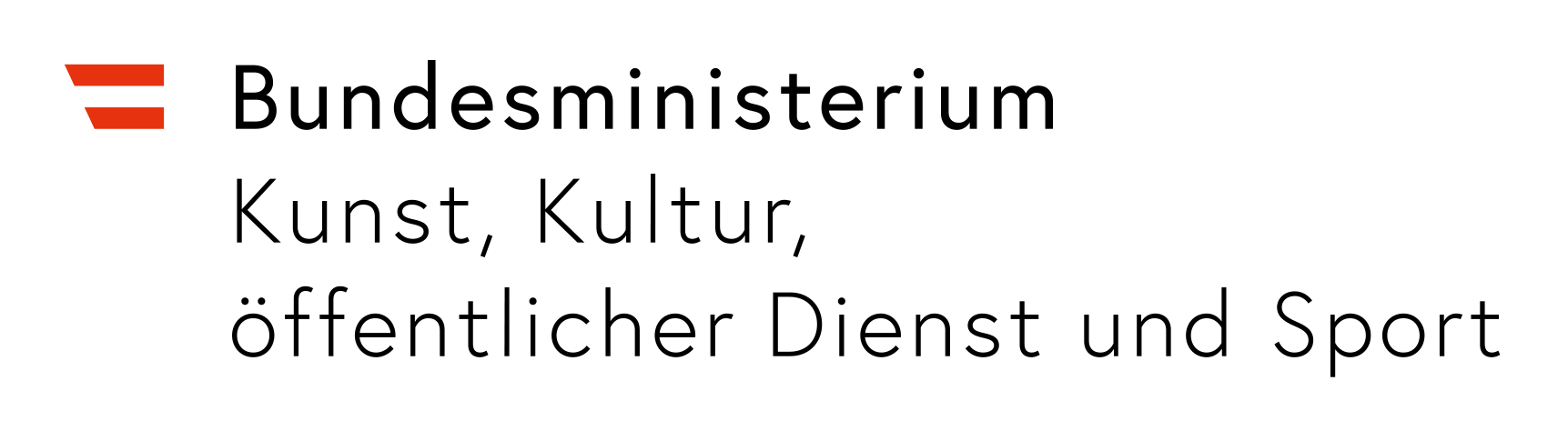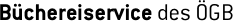Die Hoffnung im Grauen oder die große Kunst die Wahrheit zu sagen

Veröffentlicht am 07.11.2023
Heimo Mürzl über den großen französischen Schriftsteller Emmanuel Carrere.
Beim Schreiben über Schriftsteller gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Den höchsten auf der nach oben offenen Schwierigkeitsskala würde ich für das Schreiben über Emmanuel Carrere vergeben. Der 1957 in Paris geborene französische Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur gilt neben Michel Houellebecq als einer der wichtigsten, erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Autoren Frankreichs. Carrere hat die Eigenheit, dass sein Stil auf eine Weise brillant ist, wie er auf eine andere Weise ungeheuer herausfordernd ist, und so die Lektüre seiner Bücher zwar mitunter mühsam, aber letztlich lohnend macht, weil sich das Gelesene mit einer Nachhaltigkeit ins Gedächtnis brennt, wie das nur wenige Bücher tun.
„Unwissend bin ich, die Wahrheit bleibt jedenfalls bestehen.“ (Franz Kafka)
Tatsachen und Fiktion
Emmanuel Carrere setzt sich sehr gerne und meist auf virtuose Weise über gängige Gattungsdefinitionen hinweg. Er selbst spricht davon, dass seine Bücher wie „Drehbücher sind, die wir ausarbeiten, um die Wirklichkeit zu zähmen.“ Wie bei Truman Capote („Kaltblütig“) beginnt auch bei Carrere literarische Arbeit sehr oft mit Recherche auf dem Feld des Faktischen. Carreres große Kunst besteht aber darin, dass er gerne offenlässt, wo die Tatsachen enden und die literarische Fiktion beginnt. Das gekonnte Changieren zwischen minutiöser Detailtreue und fast nonchalanter Literarisierung von Wirklichkeit beherrscht Emmanuel Carrere wie kein zweiter unter den zeitgenössischen Autoren. „Was ich schreibe, mag narzisstisch und eitel sein, aber ich lüge nicht“, sagt Carrere zu seiner Arbeitsweise und seiner Verknüpfung von Tatsachen und Fiktion, um dann festzustellen: „Ich kann aufrichtig sein und mich irren: Aufrichtigkeit ist nicht dasselbe wie Wahrheit.“ Carrere erzählt stets aus der Perspektive des Ichs, das all das gerade erfährt und erlebt, und versucht, sich zu dem Stoff, den er gerade bearbeitet, in ein Verhältnis zu setzen. So sind Carreres Bücher auch immer literarische Dokumente der Skepsis bezüglich des Wesens von Kunst und ihrer Funktion. Wem soll sie dienen, was ist ihr Ziel und wo stößt sie an ihre Grenzen? Fraglos belegen Carreres Bücher aber auf beeindruckende Weise, wie sich Tatsachen und Erfindungsreichtum, Philosophie und Literatur, Recherche und Erzählfreude gegenseitig bereichern und beflügeln.
Fiktion im Rahmen des Faktischen
Emmanuel Carrere, der neben seinem Dasein als Schriftsteller immer auch journalistisch tätig war, bewegt sich in seinen Büchern sehr oft und überaus gekonnt im Spannungsfeld zwischen Fakten und Fiktion. In speziellen Fällen macht er sich auch noch Fremdmaterial zu eigen, um es zu adaptieren und für seine Werke zu formen. „Julies Leben“, ein auf 60 Seiten komprimiertes Buch zwischen Sozialreportage, Essay und Erzählung, ist beispielgebend für Carreres Arbeitsweise. 18 Jahre lang begleitete die amerikanische Fotografin Darcy Padilla die drogensüchtige, an Aids erkrankte junge Mutter Julie.
Emmanuel Carrere reist auf den Spuren dieser zwei Frauen in die USA und beginnt zu recherchieren. Die Geschichte dieser zwei so unterschiedlichen Frauen und ihrer ungewöhnlichen Freundschaft ist zugleich eine bewegende Chronik der Hoffnungslosigkeit. Carrere, der in seinen Büchern immer wieder versucht, die Wirklichkeit von ihren Rändern her zu begreifen, führt den Leser in diesem Buch sehr nah an das tragische Leben von Julie heran. Ein Leben mit sechs Kindern, zwischen Krankheit, Drogensucht, Entzügen und gewalttätigen Partnern. Das Fundament für seinen Text bilden die Fotografien und die Berichte der Fotografin Darcy Padilla.
Carrere belässt es aber nicht bei einer literarischen Reportage, sondern stellt die Frage, wie man sich als Autor einem Leben in größten Elend (literarisch) nähert und ob man den beschriebenen Menschen damit gerecht wird, in den Mittelpunkt seines Werkes. Carreres Blick auf das Schicksal dieser jungen Frau bleibt fast immer distanziert und beobachtend, seine Beschreibung nüchtern, fast kompromisslos und dennoch gelingt es ihm in diesen komprimierten sechzig Seiten gesellschaftliche Schieflagen und individuelle Lebensgeschichten auf aufrüttelnde und zugleich herausfordernde Art miteinander zu verknüpfen. „Julies Leben“ ist letztlich ein fiktionaler Text, der auf umfangreicher Recherche beruht.
Dieses Kunstgriffes bedient er sich auch bei seinem Buch „Brief an eine Zoowärterin aus Calais“. Der Rahmen des Faktischen verschafft ihm den Spielraum für seine gattungsoffene Art des Erzählens. „Nicht auch noch Sie! Calais ist zu einem Zoo geworden, und ich bin eine Kassenfrau in diesem Zoo“, schreibt eine Bewohnerin von Calais in einem Brief an Emmanuel Carrere, als er 2016 in die nordfranzösische Stadt reist, um für eine literarische Reportage zu recherchieren. Calais, einst bekannt und berühmt für die Herstellung von Webspitze, wurde in diesen Jahren nur noch als Ort von Flüchtlingscamps und als „das große Flüchtlingslager“ wahrgenommen. Carrere interessiert sich für die Bewohner der ehemaligen Industriestadt, trifft Menschen aus allen Schichten und mit den unterschiedlichsten politischen Einstellungen und versucht sich schreibend (das Buch könnte man als subjektive Reportage in Briefform bezeichnen) der Arbeitslosigkeit, der Verelendung und der damit verknüpften Fremdenfeindlichkeit, aber auch dem Idealismus mancher Bewohner von Calais zu nähern. Carrere stellt Fragen, lässt Zweifel zu, versucht die Erzählungen von Flüchtlingslager-Anwohnern, Stadtpolitikern mit seinen eigenen Wahrnehmungen abzugleichen und überlässt ein Urteil dem Leser.
Tatsachenroman in Ich-Form
Der Roman „Der Widersacher“ ist zweifellos ein Schlüsselwerk im Schaffen des französischen Schriftstellers. Darin behandelt Carrere den berühmten Fall des Hochstaplers und Mehrfachmörders Jean-Claude Romand, dessen Existenz auf Lügen und Betrug aufgebaut ist und dem es gelingt, fast zwei Jahrzehnte ein perfektes Doppelleben zu führen.
Jean-Claude Romand lebt ein scheinbar vorbildhaftes und geregeltes Leben in einer französischen Kleinstadt. Seine Familie, Nachbarn, Bekannte – alle schätzen den erfolgreichen bei der WHO tätigen Arzt wegen seiner Intelligenz und Bescheidenheit. 18 Jahre lang gelingt es Romand, sich selbst zu einer fiktiven Figur zu machen und ein auf Schwindel und Täuschung beruhendes Leben zu führen. „Ich war immer heiter, und ich glaube, meine Eltern haben von meiner Traurigkeit nie etwas geahnt (…) Ich hatte damals nichts zu verbergen, doch diese Angst, diese Traurigkeit, die habe ich verborgen (…) und wenn man einmal in dieser Mühle gefangen ist, niemanden enttäuschen zu wollen, dann zieht eine Lüge die nächste nach sich, und daraus wird dann ein ganzes Leben (…)“.
Die Lüge und die Täuschung werden in Romands Leben zur Methode – er webt ein immer dichter werdendes Netz aus Lügen und Täuschung und schafft so eine zweite Person, den „Widersacher“, der Schritt für Schritt von ihm Besitz ergreift. Die Existenz des „Widersachers“ speist sich vor allem aus der Angst vor dem Einsturz des äußeren Scheins, der sorgsam gebauten sozialen Fassade. „Eine Lüge dient normalerweise dazu, eine unangenehme Wahrheit zu verbergen, etwas vielleicht Beschämendes, aber Wahres. Die seine verbarg nichts. Hinter dem falschen Doktor Romand gab es keinen echten Jean-Claude Romand.“ Das Aufrechterhalten der Lebenslüge kostet Jean-Claude Romand nicht weniger Intelligenz und Mühe, als es die Arbeit eines richtigen Arztes erfordert hätte.
Wie aus heiterem Himmel ermordet Romand eines Tages seine Frau, seine Kinder, seine Eltern und deren Hund. Der Versuch, seine Geliebte und sich selbst zu töten, misslingt, möglicherweise gewollt. Die Ermittlungen der Polizei lassen das Lügengebäude rasch einstürzen: „Seine Forscherstelle bei der WHO, Geschäftsreisen, Konferenzen – all das hatte es nie gegeben.“ Carrere nimmt sich dieser unerhörten Geschichte an, nimmt Kontakt mit Romand auf, trifft ihn und spricht mit ihm, recherchiert bei Richtern, Anwälten, Journalisten, befragt ehemalige Freunde, wohnt seinem Prozess bei und versucht alles, um zu verstehen zu lernen, was einen eigentlich nur fassungslos zurücklässt.
An diesem Fall und mit diesem Stoff arbeitet Carrere jahrelang und entwickelt eine ganz eigene Art des Erzählens, den Tatsachenroman in Ich-Form. Je länger und genauer Carrere das Leben und die Person Romand erforscht, umso mehr macht auch er eine Wandlung durch. Er ist fasziniert von der Psyche dieses Hochstaplers und Mehrfachmörders und sein unerhörter und zugleich unerhört fesselnder Roman verzichtet auf moralische Wertungen und einfache Erklärungen, beeindruckt viel mehr mit seiner Ambivalenz aus Zweifel, Hingezogenheit, Abscheu und Nüchternheit. Die Monster, das sind immer die anderen. Weil Emmanuel Carrere natürlich weiß, dass das nicht stimmen kann, und er diesen schmerzhaft-irritierenden Gedanken auch zulässt, ist ihm mit „Der Widersacher“ ein abgründiger, fesselnder, mitunter verstörender, zutiefst menschlicher Roman gelungen, der auch von seinen Widersprüchen lebt. Was Emmanuel Carrere zur literarischen Ausnahmefigur macht, ist sein ebenso avancierter wie gekonnter Umgang mit unterschiedlichsten Genres und Stilen. Wie virtuos er literarische Reportage, historische Chronik, klassisches, autobiografisches und autofiktionales Erzählen zusammenführt und mit wieviel Verve er mit Form und Inhalt experimentiert, macht seine Art zu schreiben zu einer originären Kunst.
Dunkle Familiengeheimnisse und literarische Aneignungen
Emmanuel Carrere entstammt einer wohlhabenden großbürgerlichen Familie mit lange zurückliegendem georgisch-russischem Migrationshintergrund. In seinem Buch „Ein russischer Roman“ verknüpft der französische Autor dunkle Familiengeheimnisse und subjektive literarische Aneignungen von zeitgenössischen und historischen Personen zu einem ausgeklügelten Textgewebe, das mitunter sogar an russische Leidensgeschichten a la Leo Tolstoi und Fjodor Dostojewski erinnert. Auf Emmanuel Carrere, Sohn der französischen Politikerin, Historikerin und Russland-Expertin Helene Carrere d`Encausse (zudem erste weibliche Generalsekretärin der renommierten Academie Francaise), lastet die Vergangenheit seines russisch-georgischen Großvaters Georges Surabischiwili, eines Mussolini-Verehrers und Kollaborateurs, der am Ende des Krieges auf der Flucht von der Resistance gefangen genommen wurde und spurlos verschwunden ist.
Die ebenso aufsehenerregende wie verstörende Geschichte eines verschleppten, inhaftierten, aus der Welt gefallenen und wieder aufgetauchten ungarischen Soldaten motiviert Carrere dazu, diesem spektakulären Fall in einem Dokumentarfilm nachzuforschen. Die Arbeit an dieser Dokumentation wird sehr bald von der Spurensuche Carreres nach seinem verschwundenen Großvater überlagert und fließt in seinen „russischen Roman“ ein, der auf hochartifizielle Weise mit der Offenheit von Erinnerung spielt. In der für ihn repräsentativen Ich-Form erzählt Carrere darin vor allem von seinem grandiosen Scheitern. Wie virtuos und sich allen (literarischen) Konventionen widersetzend Carrere seine ursprünglich erdachte Geschichte in alle Richtungen mäandern lässt, Familienchronik, Reiseerzählung, Beziehungsgeschichte mit pornographischer Attitüde, Kriminalfall und russische Geschichte mit philosophischen Exkursen gekonnt miteinander verknüpft, und den Lesern auf diese Weise den Boden unter den Füßen wegzieht und sie ständig in (geistiger) Bewegung hält, ist zweifellos ein großes Kunststück.
Ein möglicherweise noch größeres Kunststück ist Carrere mit seinem Buch „Limonow“ gelungen, das mit einer faszinierenden Mischung aus Roman und Biografie dem umstrittenen und widersprüchlichen russischen Autor Eduard Limonow ein literarisches Denkmal setzt. Der Autor Carrere changiert ständig zwischen Distanzierung und Verbrüderung, wenn er wie ein literarischer Puppenspieler mit dem oftmaligen Rollenwechsel seines Romanhelden Limonow zwischen Opportunismus und Verweigerung spielt und einem (literarischen) Vampir ähnelnd, sich schamlos des umfangreichen, autobiografisch gefärbten Werks von Eduard Limonow bedient. Seine Haltung zum Menschen Limonow – Enfant terrible, Dandy, Provokateur, Frauenheld und Kryptofaschist in Personalunion – oszilliert andauernd zwischen Faszination und Abscheu und der Verzicht auf ein abschließendes Urteil macht den besonderen Reiz dieses Buches aus. Auch der Leser ist hin- und hergerissen – einerseits zieht einen die schillernde Figur Limonow mit seinem abenteuerlichen Leben in seinen Bann, andererseits wirkt der Frauenheld und Politiker verstörend und abstoßend. Das Buch, das Carrere selbst als literarische Reportage bezeichnet, ist aber vielmehr eine faszinierende Romanbiografie, die Eduard Limonow als ebenso interessante wie zwielichtige Figur zeichnet, mit vielen widersprüchlichen Facetten, die ohne die sozialen, kulturellen und politischen Gegebenheiten und Verwerfungen Russlands nicht erklärbar wären. Das menschliche Dasein ist schon ein Rätsel. Auch Emmanuel Carrere ist sich dieser Tatsache bewusst. Wichtig ist es ihm aber, die eigene Existenz, wie die menschliche Existenz schlechthin, mit offenem Geist, großer Neugierde und wechselnden Perspektiven zu betrachten.
Seine intensive Beschäftigung mit der Religion im allgemeinen und dem Christentum im speziellen gerät ihm in seinem Buch „Das Reich Gottes“ zu einem zwar ambivalenten aber letztlich beeindruckenden Bekenntniswerk, das die Frage nach den „letzten Dingen“ mit der unwägbar-absurden Komplexität menschlichen Tuns und Handelns verknüpft und in die ebenso eigenwillige wie revolutionäre Erkenntnis mündet, den sogenannten „Schwachen“ zum „Starken“ zu erklären.
Extreme Erfahrungen und tiefe Menschlichkeit
Sehr oft sind es extreme Erfahrungen und unglaubliche Katastrophen und das damit verbundene große Leid, das Emmanuel Carrere als Ausgangspunkt für seine Romane wählt. Ob es sich um das Leben eines Hochstaplers und Mehrfachmörders („Der Widersacher“), das Leid der russischen Bevölkerung („Limonow“) oder die todbringenden Verwüstungen eines Tsunamis („Alles ist wahr“) handelt. Sein Schreiben ist dabei stets von tiefer Menschlichkeit durchdrungen. „Ich weiß noch, dass Helene und ich in der Nacht vor der Welle davon gesprochen haben, uns zu trennen.“ 2004 wird Emmanuel Carrere Zeuge der Tsunami-Katastrophe. Er lernt ein junges Paar kennen, dessen Tochter von der Monsterwelle fortgerissen wird. Carrere kümmert sich um das Paar und beginnt ihre Geschichte zu erzählen.
Die Zufälligkeit des eigenen Überlebens und der Umgang mit dem Tod stehen dabei im Zentrum: „Am Abend zuvor waren sie noch wie wir und wir wie sie, aber ihnen geschah etwas, was uns nicht geschah, und jetzt gehören wir zu zwei verschiedenen Sorten von Menschen.“ Carrere hält nicht nur fest, was alles verlorengeht, wenn ein Mensch stirbt, er fügt auch immer wieder seine Selbstreflexion über das, was die Ereignisse in ihm auslösen und wie er sich dadurch verändert, in das Schreiben über „das Leid der Anderen“ ein. Zurück in Paris stirbt Carreres krebskranke Schwägerin und hinterlässt drei Kinder. Carreres bekannter Kunstgriff, Fakten und Fiktion, kollektives Erleben und Einzelschicksale, autobiografisches Material und private Gedanken, Geschichtenerzählen und Tatsachenberichte auf fast ungehörige Weise miteinander zu verquicken, ist mitunter herausfordernd, fördert aber auch grandiose Ergebnisse zutage. Den Tod kann Carrere nicht bezwingen, aber das Vergessen(werden).
„Alles ist wahr“ ist nicht einfach das Ergebnis einer minutiösen Recherche, sondern bildet den Schreibprozess und die damit verbundenen Schwierigkeiten transparent ab. Carrere beschreibt welche bürokratischen Hürden er überspringen muss, welche emotionalen Rückschläge er dabei erleidet und wie ambivalent Glück empfunden werden kann. Das Unglück der Anderen wird ihn und auch seine Beziehung retten. Carrere erzählt davon mit sachlicher Aufrichtigkeit und dem notwendigen Schamgefühl gegenüber den Opfern. So wird „Alles ist wahr“ zu einem beredten literarischen Zeugnis von tiefer Menschlichkeit. Der autofiktionale Habitus ist ein Markenzeichen der Literatur von Emmanuel Carrere.
Auch in seinem Buch „Yoga“ steht die Erforschung des Selbst im Zentrum und Carrere erzählt mit einer ausgewogenen Mischung aus Ehrlichkeit und Eitelkeit. Die schonungslose Selbstanalyse besticht durch Offenheit und Intensität und verhandelt die Frage, was Wahrheit ist, wie und wo man sie suchen und finden könnte und das jeder Roman letztlich eine Fiktion ist und als solche ganz eigene Wahrheiten erzählt. Carrere plant ein vergnügliches Buch über die Kunst des Yoga zu schreiben und begibt sich zu Recherchezwecken in ein Meditationszentrum in der französischen Provinz. Am fünften Tag seines Aufenthalts ermorden Islamisten zwölf Menschen in den Redaktionsräumen der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Unter den Opfern befindet sich auch ein Freund von Carrere. Als sich dann auch noch seine Frau von ihm trennt, gerät Carreres Dasein zunehmend aus den Fugen. Diese Ereignisse erschüttern Carrere so stark, dass er die Kontrolle über sein Leben verliert: „Obwohl ich meine Situation nicht mit viel schlimmeren Schicksalsschlägen vergleichen möchte, ist eine tiefe Depression – eine so genannte melancholische Episode – wirklich eine menschliche Grenzerfahrung. Die vielen Zuschriften von Leuten, die ähnliches durchgemacht haben, bestätigen das.“
Schonungslos – auch gegenüber sich selbst - und mit erschreckender Intensität beschreibt Carrere in seinem autofiktionalen Roman von psychischen Problemen, von der niederschmetternden Diagnose einer bipolaren Störung und der Anwendung des „allerletzten Mittels“, einer Elektroschocktherapie. Um gegen den Gedächtnisverlust anzukämpfen – eine Nebenwirkung der Elektroschocktherapie – beginnt er mit Gedächtnistraining und damit Gedichte auswendig zu lernen. Vier qualvolle Monate verbringt Carrere in der Psychiatrie, ehe er auf der Suche nach „Heilung und innerem Frieden“ auf der griechischen Insel Leros bei unbegleiteten Geflüchteten landet. Die Begegnung mit den minderjährigen Geflüchteten – auch sie haltlos und ausgeliefert, mit der Sehnsucht nach Nähe und innerem Frieden – hilft ihm, er lernt Demut und er findet Trost und Halt durch Gespräche und Musik. Die Dreiteilung des Buches in eine Yoga-Episode, eine Trauma-Episode und eine Episode, die unter unbegleiteten Geflüchteten auf der Insel Leros spielt, spiegelt nicht nur das Chaos der Welt, sondern offenbart auch auf kunstvolle Weise die Angreifbarkeit und Zerrissenheit des Menschen Emmanuel Carrere.
Die Hoffnung im Grauen
Vendredi treize – Freitag, den 13., kurz V13 steht für eine Nacht voller Grauen. IS-Terroristen sorgten am 13. November 2015 in der französischen Hauptstadt Paris für ein Massaker mit 131 Toten und 700 zum Teil schwer verletzten Opfern. Sechs Jahre später wird das Geschehen in dem bis dahin größten Terror-Prozess der französischen Geschichte vor Gericht aufgearbeitet. Emmanuel Carrere machte es sich zur Aufgabe, den Gerichtsprozess von Anfang an bis zum Ende genau zu beobachten und seine Eindrücke in einer wöchentlichen Gerichtsreportage im Nouvel Observateur niederzuschreiben. Sein aktuelles Buch „V13“ ist eine überarbeitete, aktualisierte und klug ergänzte Gerichtsreportage – und doch viel mehr.
Eine gelungene Mischung aus Reportage und Essay, oft sehr persönlich, meist elegant, immer empathisch, manchmal pathetisch, aber stets ausgestattet mit einem nüchtern-klaren Blick für das Wesentliche. Eine intensive Leseerfahrung, der man sich kaum entziehen kann. Die Opfer, die Täter, das Gericht – das Buch ist in drei große Abschnitte unterteilt. Wobei Carrere den Überlebenden und Hinterbliebenen und ihren Aussagen den größten und stärksten Teil seines Buches widmet. Ohne Sensationsgier, aber in einer mitfühlenden Haltung lässt Carrere den Leser an diesem einzigartigen Gerichtsprozess teilnehmen – auch mit dem Vorsatz Unfassbares etwas fassbarer zu machen und im fast unbeschreiblichen Grauen und im tiefsten Dunkel doch auch Hoffnung, Liebe und Licht zu entdecken.
So rückt Carrere am Ende des Prozesses auch nicht das Urteil in den Mittelpunkt, sondern das Mitfühlen einer Gemeinschaft: „Als hätten wir eine neunmonatige Reise auf einem großen Schiff gemacht. Und wir sind dann im Hafen angekommen. Der Prozess ging zu Ende und es war klar, die Justiz hat ihre Arbeit gemacht. In diesem Moment fiel eine unbeschreibliche Anspannung von uns allen ab – und wir konnten gehen. Für uns alle war das ein überwältigender Moment.“
Foto (c) Verlag Matthes & Seitz Berlin