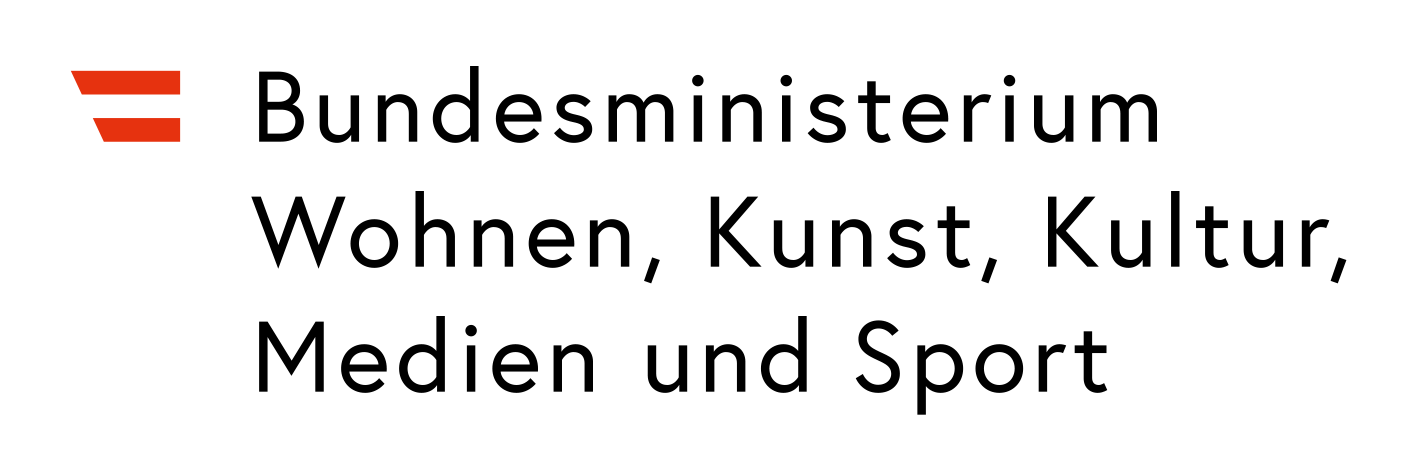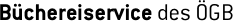Doris Dörrie - Schreiben heißt, die Welt einatmen

Veröffentlicht am 07.11.2021
Karin Berndl über die Schriftstellerin und Filmemacherin Doris Dörrie
„Schreiben heißt, die Welt einatmen. Nicht nur die kühle Bergluft am Morgen, auch den Smog, den Rauch, die Abgase. Das Schöne wie das Hässliche“ („Leben, schreiben, atmen. Eine Einladung zum Schreiben“, 2019). Diese Bandbreite des Lebens, das gesamte Spektrum an Emotionen und Gefühlen menschlicher Existenz beschreibt Doris Dörrie in ihren Filmen und Büchern kompromisslos und beständig seit Jahrzehnten. 1955 in Hannover geboren, wächst sie in einem Haus mit vielen Büchern auf. Die Eltern sind Ärzte, ihr Onkel Heinrich Dörrie ist Altphilologe. Dörries Vater ist der Geschichtenerzähler in der Familie und ihre Mutter die genaue Beobachterin, erzählt sie immer wieder in Interviews. Sie wächst zusammen mit drei Schwestern auf und Lesen wird zum rettenden Rückzugsort aus dem turbulenten Familienalltag. Wenn sie nicht schlafen kann, beobachtet sie ihre Eltern, die abends meist lesend und Schokolade essend im Wohnzimmer sitzen. Einen Fernseher gibt es im Hause Dörrie nicht.
Nach dem „Erweckungserlebnis“ Lesen entdeckt sie das Schreiben und was alles mit der Sprache entworfen und gestaltet werden kann. Schon als Kind imitiert sie in eigenen Geschichten das Gelesene und präsentiert es ihren Schwestern. „Als ich lesen konnte, fiel mir auch das Schreiben mit einem Mal leicht. Ich durfte in der Klasse vorlesen und die saubere Doris nicht. Ich las dicke Märchenbücher, verirrte mich im Wald, pflückte mit bloßen Händen Brennnesseln, zählte Erbsen, sprach mit meinen Brüdern, die in Schwäne verwandelt waren, fror bitterlich in einem Hemdchen im kalten Schnee und schluchzte über mein schlimmes Schicksal“ (Leben, schreiben, atmen – Eine Einladung zum Schreiben, 2019).
1973 startet sie zu einem zweijährigen Aufenthalt in den USA, wo sie Schauspiel und Film am Drama Department der „University of the Pacific“, Kalifornien studiert. Auch schreibt sie sich an der New School for Social Research in New York ein. Für ihren Lebensunterhalt jobbt sie in Cafés als Kellnerin oder als Filmvorführerin. Doch das Leben in den Vereinigten Staaten ist anstrengend und zehrend für die junge Frau. Auf Anraten ihrer Mutter kehrt sie nach München zurück und nimmt 1975 ihr Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film auf und schreibt als Redaktionsassistentin Filmkritiken für die „Süddeutsche Zeitung“. Danach ist Dörrie freie Mitarbeiterin für verschiedene Fernsehsender und dreht ihre ersten kleineren Dokumentarfilme.
Große Lieben
Auf der Filmhochschule lernt sie ihren späteren Ehemann Helge Weindler kennen, den Kameramann einer Vielzahl ihrer Filme. Sie heiraten 1988 und 1989 kommt die gemeinsame Tochter Carla zur Welt. Eine weitere große Liebe und zweite Heimat soll Japan werden. Das erste Mal reist sie 1983 zum Filmfestival nach Tokio, wohin sie mit ihrem Spielfilm-Debüt „Mitten ins Herz“ eingeladen wird. Das absolut Fremde fasziniert sie von Beginn an, belebt sie, inspiriert sie zum Schreiben und neuen Geschichten. Sie trampt eine Weile durch Japan, um das noch Fremdere zu erleben und erfahren. Mehr als dreißig Mal soll sie nach Japan reisen und fünf ihrer Filme dort drehen.
Mit ihrem dritten Film „Männer (1985)“ wird sie einem breiten Publikum bekannt und ihr Film zum erfolgreichsten deutschen Film des Jahres. Heiner Lauterbach mit Affenmaske und Morgenmantel auf dem Hausdach sitzend oder mit Uwe Ochsenknecht nackt mit Koffer in der Hand im Paternoster stehend, sind wohl die zwei eindrücklichsten Szenenbilder, die nach den vielen Jahren sofort wieder vor dem geistigen Auge aufblitzen. Zwischen dem ernsthaften Kunstfilmen und den ulkigen Komödien der 1980er Jahre beschreitet Dörrie mit ihren intelligenten und humorvollen Geschichten neue Wege im deutschen Film. „Der Spiegel“ titelt sie in der Ausgabe 45/1986 als Deutschlands erfolgreichste Regisseurin.
Auch der geschäftstüchtige Verleger Daniel Keel (Diogenes Verlag) wird durch den großen Erfolg von „Männer“ auf die produktive Geschichtenerzählerin Doris Dörrie aufmerksam und ermutigt sie, ihre Geschichten, die damals Grundlage für ihre Drehbücher sind, doch zu Erzählungen zu machen und zu veröffentlichen. Lange bleibt sie in Deckung, versteckt sich hinter ihren Filmen und Drehbüchern, denn Schriftstellerin zu sein, scheint ihr zu hoch gegriffen. In Interviews später wird sie erzählen, dass Daniel Keel ihr den entscheidenden Anstoß gegeben, um bewusst mit dem Schreiben zu beginnen.
1987 erscheint ihr erstes Buch bei Diogenes: „Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug“. Der Titel beruht auf dem gleichnamigen Spielfilm unter der Regie von Alan J. Pakula , der 1973 in die Kinos kommt. „Vier Filmstories“ lautet der Untertitel der Geschichten, aus denen heraus die Autorin ihre Filme entwickelt, die bereits verfilmt sind oder danach für die Leinwand adaptiert werden. Es folgen die Erzählbände „Was wollen Sie von mir?“ (1989), „Für immer und ewig. Eine Art Reigen die Erzählung“ (1991) und die Erzählung „Der Mann meiner Träume“ (1991).
Sie zeigt sich darin als genaue Beobachterin des Alltags, von Beziehungen und gesellschaftlichen und zeitgeistigen Phänomenen dieser Zeit. In einem Interview im „Spiegel“ sagt sie dazu: „Wenn man ganz präzise erzählt, kann man vielleicht universell werden, wenn man versucht, universell zu sein, kommt nur fades Zeug raus“.
1995 erscheint der Band „Bin ich schön?“, mit sechzehn Erzählungen. Darin zeigt sie vor allem, wie Frauen und Männer gleichermaßen in den unendlich erscheinenden Möglichkeiten der Lebens- und Beziehungsgestaltung scheinbar frei wählen können und nichts wie erhofft leichter, sondern eher komplizierter wird. Es sind Menschen, die mehr oder weniger gewollt allein leben, junge Mütter, Ehepaare, ältere Singles. Drei Jahre später kommt der gleichnamige Episodenfilm mit Staraufgebot ins Kino. Claudia Lübbke schreibt in ihrer Filmkritik: „Dörries Menschen sind auch nicht immer schön. Aber wenn sich der unästhetisch übergewichtige Werner (Gustav-Peter Wöhler) von einer gleichgültigen Linda auspeitschen lässt, wenn seine Grunzlaute den Kinosaal erfüllen, selbst dann verliert er seine Würde nicht. Dörrie ist das Kunststück gelungen, Fortuna in all ihren Absonderlichkeiten zu zeigen, und das macht diesen Film so wahrhaftig schön.“
1995 dreht sie „Keiner liebt mich“, in der Titelrolle Maria Schrader als verschrobene Fanny Finck, die zwischen Lebensfreude und Todessehnsucht durch ihr Leben stolpert, in einem Kurs zum „selbstbestimmten Sterben“ landet, selbstgebauten Sarg und Probeliegen inklusive, und die Hoffnung auf einen Partner mit fast dreißig Jahren aufgegeben hat. Unzufrieden mit ihrem Job am Flughafen, wohnt sie in einem desolaten Hochhaus und droht in der Anonymität der Großstadt unterzugehen. „Halb voll ist dir immer zu wenig“, sagt in einer Szene Orfeo, Hellseher und selbsternanntes Medium, den Fanny konsultiert und der bald ihr bester Freund werden soll und ihr natürlich auch eine große Liebe prophezeit. Orfeo ist Künstler, schwul und schwer krank. Er stirbt an Fannys Geburtstag bei ihrer Feier, nicht ohne vorher Voodoo-Zauber zu verbreiten, der seine Wirkung tut. Fanny erkennt schließlich, dass es freundschaftliche Liebe ist, die sie mit Orfeo erleben durfte.
1996 während der Dreharbeiten zum Film „Bin ich schön?“, die in Spanien stattfinden, stirbt Doris Dörries Ehemann Helge Weindler an einer Hirnhautentzündung, nachdem er gerade eine Krebs-Erkrankung überwunden hat und als gesund galt. Dörrie nimmt sich daraufhin ein Jahr Auszeit. Die gemeinsame Tochter ist nicht einmal zehn Jahre alt. Welche Wege sie gefunden hat, nach diesem Verlust weiter zu leben, was ihr wieder Mut zum Weiterleben gegeben hat, findet sich durchwegs auch in den Motiven ihrer Bücher und Filme wieder.
Im Erzählband „Samsara“ (1998) widmet sie sich dem ewigen Kreislauf weiblicher Erbsünde und dem Hang von Frauen zum Unglücklichsein. Sie zeigt dies an historischen und gegenwärtigen Geschichten und Figuren, die heute beispielsweise ihren Ausdruck in Essstörungen finden. Glückssuche, Buddhismus, fernöstliche Weisheiten sind zentrale Themen in ihren Geschichten um die Jahrtausendwende.
Erleuchtung garantiert
Zeitgleich mit ihrem Film „Erleuchtung garantiert" entsteht ihr erster Roman: „Was machen wir jetzt?“ (2000). Fred Kaufmann, ein Imbissketten-Besitzer aus dem Münchner Umland, ist der Prototyp eines mittelständischen Bundesdeutschen, und naturgemäß in Dörries Filmen und Büchern auf dem Weg in oder bereits in der Lebenskrise. Freudlosigkeit trotz Überfluss, eine siebzehnjährige Tochter, die sich in einen Lama verliebt hat und eine Ehefrau, die abends lieber meditiert als mit ihm Zeit zu verbringen. Die Geschichte nimmt Fahrt auf als die Tochter in einem französischen Kloster ihren Lama treffen will, um mit ihm nach Indien zu reisen. Der erschöpfte Großstädter will die Tochter retten und findet auf der Reise mit seiner Tochter, in der Begegnung mit einer anderen Frau, dem Liebhaber der eigenen Frau, wieder ein wenig zu sich und lernt dabei auch noch richtig atmen.
„Erleuchtung garantiert“ ist der erste Film, den sie in Japan dreht, und der in der Unmittelbarkeit der Szenengestaltung und dem bescheidenen Umgang mit den Mitteln (es wurde ausschließlich mit Amateurkamera gedreht) hervorzuheben ist. Dörrie zeigt beispielhaft, dass sie bei den Bedingungen für das Schreiben und bei den Produktionsbedingungen ihrer Filme alles andere als zimperlich ist. Es ist eines ihrer Credos bei den Bedingungen für das Leben wie auch für ihre Arbeit nicht zu anspruchsvoll zu sein – bei diesem Film wird oft ohne Genehmigung gedreht, und die gesamte (kleine) Crew muss den Alltag im buddhistischen Kloster mittragen – Bodenschruppen und Küchendienst inklusive.
Doris Dörrie versteht es, mit einer Leichtigkeit zu erzählen „mit einem erzählerischen Übermut und einer Unbeschwertheit, die in der deutschen Literatur sonst kaum einer besitzt“ (Michael Althen, Süddeutsche Zeitung, 19.01.2000). Ende der 1990er Jahre beginnt die bereits bekannte und erfolgreiche Autorin und inzwischen Professorin für Angewandte Dramaturgie und Stoffentwicklung an der Hochschule für Fernsehen und Film München auch Kinderbücher zu schreiben, wie die Lotte-Reihe „Mimi“, wofür sie 2002 den Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen bekommt. „Aber das feste Land ihrer einsamen, langweiligen Trauer will sie doch endlich verlassen!“
Das blaue Kleid
Spiritualität, Leben, Tod, Liebe, Trauer, das Fremde sind die Themen, die sie in ihrem schriftstellerischen Arbeiten neugierig voran weitertreiben. In „Happy“ (2001) zeigt sie kinderlose Paare und ihr Ringen um das Glück. In „Das blaue Kleid" ist der Verlust des Partners zu verkraften. Die sechsunddreißigjährige Babette kauft am 23. März 2000 das titelgebende blaue Kleid des Modeschöpfers Alfred Britsch: „Dieses Kleid! Ruft er, dieses Kleid wird ihr Leben verändern!" Das Kleid ist für die heißersehnte Reise mit ihrem Partner nach Bali gedacht, Doch ihr Mann stirbt am ersten Urlaubstag beim achtlosen Überqueren einer Straße. Babette bleibt im Urlaubsparadies, ist mit seltsamen Trauerritualen und Betroffenheit konfrontiert. Sie kehrt nach Deutschland zurück, wo sie der Trauerprozess natürlich eiskalt erwischt und eine riesig große Leerstelle des Verlustes klafft: „Schritt für Schritt geht sie durch die Jahreszeiten. Jede Jahreszeit bringt neue, überraschende Schmerzen. Wo ist der große Tulpenstrauß, den er ihr jeden Frühling geschenkt hat, wo seine berühmte Frankfurter Sauce mit sieben Kräutern im Mai, wo ist sein braungebrannter Julibauch?“ („Das blaue Kleid“).
Parallel dazu verliert Florian seinen Lebensmenschen Alfred Britsch an Krebs. Das letzte Kleid, das er anfertigt, ist besagtes blaues Kleid. Eine Straßenmusikerin in Tschechien inspiriert ihn zu diesem Entwurf. Auf der Rückreise hört das Paar die Lieder der Sängerin, der sie eine Kassette aufgekauft haben, damit sie sich fotografieren lässt. Florian erinnert sich: „Schwere, böhmische Balladen, die uns beide schon wieder zum Heulen brachten, aber dieses Mal war’s ein schönes, kitschiges Heulen, was nicht Wunden reißt in der Brust, sondern ein Weinen wie früher, von dem man weiß, wenn es aufhört, ist alles wieder gut“.
Florian begleitet seinen Partner durch die Phasen seiner Krebsbehandlung, erhofft sich aus exotischen Wundermitteln, Heilung, aber das kann den Partner nicht retten. Florian macht sich auf die Suche nach dem letzten verkauften Kleid aus der Frühlingskollektion und landet vor der Türe der angeschlagenen Babette, die sich gerade am Beginn einer Beziehung mit Thomas, einem erschöpften, introvertierten Anästhesisten im Schwabinger Klinikum befindet. Babette und Florian werden eine Trauergruppe, wobei jeder ganz unterschiedlich mit dem Verlust umgeht. Mit ihren Figuren zeigt Dörrie auf berührende Weise, dass Leiden und Trauer oft mehr Verbindung zwischen Menschen herstellen kann als schöne Erlebnisse und Erfahrungen.
„Wie sehr ist alles, was wir tun, nur Reaktion auf das, was davor war? Fügt sich einfach eine Masche an die andere, die ohne ihre Vorgängerin überhaupt nicht existieren könnte, wie Strickmaschen in einem Pullover? Der Pullover meines Lebens hatte am Saum ein sehr wirres unregelmäßiges Muster, dafür war das letzte große Stück glatt rechts gestrickt, schön regelmäßig und ohne Fehler.“ Es wäre nicht Dörrie, wenn Babette und Florian nicht kurzerhand kurz vor Alfreds ersten Sterbetag spontan einen Flug nach Mexiko buchen, um dort den „Día de Muertos“ zu begehen. Mit diesem alljährlichen Fest, zahlreichen Tanzveranstaltungen, Schädeln aus Zuckerguss und Picknick auf den Gräbern erhält der Tod eine Präsenz in der Gegenwart, zwischen Ekstase und Verzweiflung. Die Kritik rezeptiert Dörries Roman teilweise todernst und mit einem Anspruch, den die Autorin gar nicht verfolgt oder gerecht werden will. Trauer ist etwas sehr privates und persönliches und ein Verlust wird von jedem auf andere Weise bewältigt und verarbeitet. Dörries Stil ist leicht, gleitet naturgemäß mal ins Banale ab, ins Kitschige, wie das Leben halt auch oft ist. Sie packt mutig die großen Themen Liebe und Tod aus eigenen schmerzhaften Erfahrungen an, immer lebensklug und ohne Sentimentalität mit einer riesigen Dosis Humor und distanzierendem Klamauk.
Dörrie muss im Umgang mit der Kritik seit jeher viel einstecken. Doch wer in seiner Zeit als Frau so erfolgreich neue Wege beschreitet, wird schnell zur Angriffsfläche verkniffener und sich moralisch überlegen fühlender Kritik. Auch als sie aufgrund ihrer Popularität eingeladen wird, an der Staatsoper Berlin „Così fan tutte“ (2001 mit Daniel Barenboim) zu inszenieren, nimmt sie diese Aufgabe mit ungebrochener Neugier am Fremden und Neuen an und beschert dem Haus die erfolgreichste Produktion der Saison. Kokettierend bezeichnet sie sich den Journalisten gegenüber als „Opern-Trottel“ und bewegt sich weiter auf ihr fremden Metier, darin ist sie gut. Sie bedient die Gefühlsmaschine der Hochkultur und 2003 folgt „Turandot“ (mit Kent Nagano). Als sie 2005 an der Bayerischen Staatsoper Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ unter Zubin Mehta inszeniert, muss sie herbe Kritik aushalten. Sie verlegt die Handlung auf den „Planet der Affen“ und ihre Inszenierung wird für die Opernwelt zum „Ärgernis der Saison“.
Und was wird aus mir?
In „Und was wird aus mir?“ (2007) setzt sie sich mit diesem Scheitern ironisch auseinander. Eine ihrer sechs Protagonistinnen Johanna, nun Requisiteurin, nachdem sie als Schauspielerin in Hollywood gescheitert ist, flüchtet nach ihrer Entlassung wieder nach Los Angeles, nicht ohne im Flieger ihrer Nachbarin in ihrer Verzweiflung „La donna è mobile” anzustimmen, die die naheliegende Assoziation zum Werbejingel eines Tiefkühlpizzaproduzenten herstellt, womit sich Dörrie mit ihrer Opern-Dilettanterie wohl selbst ein wenig aufs Korn nimmt. Besagte Johanna unterstützt ihren Jugendfreund Rainer, einst aufstrebender Jungregisseur, bei seiner alljährlichen Laienaufführung für seine Tochter Allegra, bei der er ihr den erfolgreichen Hollywood-Regisseur mit Villa, Sportauto und ungebrochenen Angeboten an neuen Projekten vorgaukelt. Dörrie greift das Leitmotiv Rigolettos auf und lässt Tochter Allegra dem halbseidenen Schauspieler Marko und Besitzer besagter Villa verfallen. Rainer Fieling ist ihr Rigoletto, eine Art von moderner Hofnarr, der sich für den kleinsten Auftrag in Hollywood zum Affen macht. Alle Verflechtungen bringen die verworrenen Geschichten ihrer Figuren zutage, die Dörrie mit überbordendem Ideenreichtum schillernd in Szene setzt. Der Roman endet jedoch nicht wie bei Rigoletto mit einem tragischen Todesfall, sondern die Handlung löst sich mehr oder weniger klamaukig auf, so wie sie den gesamten Roman aufbaut. Weniger wäre manchmal mehr gewesen, aber bei der glamourösen amerikanischen Filmwelt ist wohl auch oft mehr Schein als Sein. Sie schreibt nicht nur Geschichten für das Kino im Kopf, sondern schafft es auch in ihren Filmen berührende, poetische Bilder von tiefer Menschlichkeit zu gestalten, die lange nachwirken. 2008 gelingt ihr das in ihrem Film „Kirschblüten – Hanami“ mit Elmar Wepper, Hannelore Elsner in den Hauptrollen, der Weltpremiere auf den Filmfestspielen Berlin 2008 feiert. Für Elmar Wepper in seinen 60ern startet damit eine Karriere auf der großen Leinwand. Hannelore Elsner, die zehn Jahre später sterben soll, kann darin (wie auch in „Alles inklusive“) die Größe ihres Könnens verewigen.
Tadashi Endo, ein Butoh-Tänzer und enger Freund von Doris Dörrie, unterrichtet die beiden Hauptdarsteller in dieser Tanztechnik für die zentralen Szenen des Filmes. Ankoku Butō (dt. Tanz der Finsternis) wurde in Japan als Antwort auf den europäischen Ausdruckstanz des ausgehenden 20. Jahrhunderts gesehen. Nicht die Schönheit des Körpers, sondern seine Versehrtheit, seine Schwächen, Grenzen, Brüchigkeiten finden in dem Schattentanz ihren Ausdruck. In den eindrücklichsten Filmszenen in „Kirschblüten – Hanami“ tanzt der weiß geschminkte Rudi Angermeier (Elmar Wepper) mit dunkel umrandeten Augen und rot überzeichneten Lippen – im Hintergrund ist der Fuji zu sehen – für seine verstorbene Trudi (Hannelore Elsner) den Butoh. In ihrem liebsten Morgenmantel bewegt er sich zu eindringlichen Klängen und dann taucht auch Trudi noch einmal auf und sie sind im Tode vereint. Rudi liegt am Ende der Szene tot am Ufer des Sees, in dem sich der Fuji im Morgenlicht spiegelt. Wir Menschen verbinden uns über unsere Schwächen, das zeigt sie in ihren Texten und Filmen. Schicksalsschläge, Trennungen, aussichtslose Lagen bringen überraschende Begegnungen und Wendungen. „Wie sehr ist alles, was wir tun, nur Reaktion auf das, was davor war?, fragt Babette in „Das blaue Kleid“.
Alles inklusive
In „Alles inklusive“ (2011) spürt Dörrie dem Klischee des verheißungsvollen Südens als Sehnsuchtsort nach und zeigt darin, wie die Vergangenheit in die Gegenwart wirkt. Vor dreißig Jahren hat Ingrid als Blumenmädchen mit ihrer Tochter Apple am Strand des südspanischen Torremolinos Schmuck verkauft und von Liebe, Luft und Meer gelebt. Als sie mit einem deutschen Familienvater, der mit seinem Sohn Tim und seiner Frau den Urlaub hier verbringt, eine Affäre beginnt, gerät nicht nur das Leben ihrer Tochter Apple, sondern das aller Beteiligten ins Wanken. Dreißig Jahre später kehrt Ingrid mit Apple und deren gehbehinderten Hund Dr. Freud, den sie siezt, an den Ort zurück. Tim ist inzwischen Tina und lebt als Fußpflegerin und Sängerin im Ferienort. Apple, hochneurotisch und zwänglich, sieht die Schuld für ihre scheiternden Beziehung und ihre Ängste in ihrer instabilen Mutterbeziehung. Ingrid erkennt, was aus ihren Träumen geworden und welchen Preis diese hatten. Verpasste Träume, Trennungen, Tod, Einsamkeit, Krankheit und enttäuschte Hoffnungen und verpfuschte Lebensentwürfe machen auch vor dem sonnigen Süden nicht Halt. Auch die Verfilmung mit bereits von anderen Filmen bekannten Schauspielern wird ein Erfolg und ist beste Unterhaltung im deutschen Gegenwartskino. Doch Doris Dörrie ist auch im literarischen Betrieb längst angekommen und etabliert: „Alles inklusive“ landet sofort auf der Bestseller-Liste. „Schriftstellern sollte man aus dem Weg gehen. Sie sind Diebe und Vampire, allesamt“.
In „Diebe und Vampire“ erzählt sie über den Literaturbetrieb und seine Akteure, den Anfängern, ihren Idolen, den Bedingungen für das Schreiben, den Erfolg, Inspiration und Konkurrenz. Sie verhandelt dies über Alice, eine erfolgreiche Schriftstellerin und ihren harten Weg zum Erfolg. Im ersten Teil reist Alice mit einem Sugar-Daddy, einem Chirurgen, nach Mexiko, wo sie über ihren Status Quo und ihrem Wunsch Schriftstellerin zu werden, nachdenkt. „Ich dachte mir gerne Geschichten aus. Ich liebte Geschichten. Man hätte auch sagen können, ich log gern, aber ich dachte, dass ein gewisses Talent zur Lüge als Grundvoraussetzung fürs Schreiben nicht das Schlechteste war.“ Dabei beobachtet sie eine elegante, reife Frau, die alles zu haben scheint, was die junge Frau begehrt und ersehnt. Sie studiert sie über Tage, ihre Gewohnheiten, ihre Gesten, sucht ihre Nähe.
Die Meisterin“ ist Schriftstellerin und verkörpert all das, was die Erzählerin gerne erreichen würde, auch als sie mehr die Hintergründe und ihr Leben erfährt. „Wieso fürchtete sie sich nicht vor dem Alleinsein, dass das Schreiben doch mit sich brachte? Wie konnte sie diesen Zustand jedem anderen vorziehen?“ Sie erfährt auch aus dem ernüchternden Alltag des Schreibhandwerks: „Meistens schreibe ich shit. Aber ich denke, es ist besser, wenn ich shit schreibe, als wenn ich nichts schreibe, denn wenn ich nicht schreibe, entmutigt es mich mehr, als wenn ich shit schreibe. Ich genieße einfach, dass ich es jeden Tag machen darf und nicht mehr heimlich und nebenbei wie früher, als ich noch Hausfrau und Mutter war.“ „Die Meisterin“ hat immer wieder Schreibblockaden und muss sich immer wieder den Angriffen der Kritik aussetzen, die sie als schreibende Hausfrau bezeichnet. Doch ist sie auch dreist genug, Alice „ihre Geschichte“ von Fernando zu stehlen, einem Jungen im Männerknast, auf den sie sie aufmerksam macht. „Die Meisterin“ lädt Alice schließlich am Ende des ersten Teils ein, sie in die Vereinigten Staaten zu besuchen. Doch die Vorstellungen über diesen Besuch können unterschiedlicher nicht sein. Statt liebevoll unter die Fittiche genommen zu werden, muss Alice tagelang warten, um ins Allerheiligste vorgelassen zu werden und wird mit einem Mittagessen mit dem Mann der Meisterin abgespeist. Nach dieser Enttäuschung kommt der Jungautorin in der Fremde das Leben und die Liebe dazwischen.
Im dritten Teil, dreißig Jahre später, hat es auch Alice geschafft. Sie ist eine erfolgreiche Autorin, die eine eingeschworene und treue Fangemeinde hat. Doch nicht Romane haben ihr den Erfolg beschert, sondern eine Anleitung zu Schreiben mit dem Titel „Sei ein Held! Schreib!". Schreiben ist für die alternde Alice Mittel, um mit Verlusten, Einsamkeit und Schmerz umzugehen. Und auch sie ist zu einer Meisterin des Fachs und eine ebensolche Vampirin geworden: „Ich roch, dass sie wirklich schrieb, und vielleicht gar nicht mal schlecht. Wer wirklich schreibt, bekommt nichts von mir. Ich ermuntere nur die, die davon träumen, es aber nie schaffen werden.“ Sie selbst hat nie einen eigenen Schreibplatz gehabt und irgendwie auch nicht gebraucht, sagt sie in einem Interview. Sie schreibt viel im Bett und in der Küche. „Der beste Ort, um Veränderung zu üben und zu studieren, ist die Küche“.
„Die Welt auf dem Teller. Inspirationen aus der Küche“ (2020) sind Erinnerungsstücke, Lobeshymnen, kritische Blicke auf Produktionsbedingungen, kleine Liebeserklärungen, wenn sie über grünen Tee und Onigiris schreibt: „Der Geschmack von grünem Tee, Reis und salziger Pflaume – was könnte japanischer sein?“ „Es hat viele Jahre gedauert, bevor mir auffiel, dass ich immer die Einzige war, die auf der Straße aß oder trank. Bis heute setzt man sich in Japan hin zum Essen und Trinken (wie früher bei uns auch). Man widmet seine Aufmerksamkeit selbst einem Reisbällchen. Und verbeugt sich sogar kurz vor ihm: itadakimas. Man bedankt sich beim Reis, bei der Pflaume, beim Seetang für die reizende Unterstützung in unserem Leben. Und für die tolle Verpackung. Nein, nicht im Ernst. Das mache nur ich.“ Dörrie outet sich in diesem Band als Brotfanatikerin, erzählt die Geschichte ihrer Liebe zur vietnamesischen Reisnudelsuppe Phở, am Beispiel von Safran skizziert sie die Kulturgeschichte des erlesenen Gewürzes, sie erinnert sich an die Beleuchterbrotzeit, lässt die Butterbrezn und den Kohlrabi hochleben, erklärt, warum Haferbrei zum trendigen Superfood wurde und die mafiösen Strukturen hinter den Produktionsbedingungen des allseits beliebten grünen Goldes, der Avocado. Sie unterstreicht auch die Bedeutung der gemeinsamen Mahlzeit als sozialen Kitt.
Wir alle sind Geschichtenerzähler
Auch Dörrie gibt inzwischen nicht nur als Professorin an der Filmhochschule ihre Erfahrungen weiter und ermutigt zum Schreiben. Unter dem Motto „Alles Echt. Alles Fiktion“ kuratiert sie 2017 das forum:autoren auf dem Literaturfest München. 2019 erhält sie eine Einladung zur Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar verleiht. Immer am selben Ort zu sein, ist für die vielbeschäftigte Dörrie nichts. Sie lebt in München und Bernbeuren im Allgäu, wenn sie nicht gerade unterwegs auf Filmfestivals, an Universitäten zu Schreibkursen oder zu Lesungen ist.
Doris Dörrie ist überzeugt, dass jeder das Handwerk des Schreibens erlernen kann. Sie diagnostiziert unserer Zeit, dass sich die Menschen immer weniger persönlich erzählen, sich lieber digital erzählen lassen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern. Es geht ihr darum, die Welt, in der man sich befindet, genau zu beschreiben, nicht vorrangig seine inneren Zustände. „Zu schreiben bedeutet, sich jeden Tag wieder aus dem kleinen, ordentlichen Garten mit gemähtem Rasen und Blumenrabatten herauszuwagen in den Dschungel. Dorthin, wo wilde Pflanzen wachsen und gefährliche Tiere umherstreifen. Dorthin, wo die Geschichten nicht mehr hübsch und ordentlich sind, sondern schillernd, giftig, schmerzhaft und wüst. Interessant ist nie die Beschreibung unseres schönsten Ferientags, sondern die des schlimmsten. Wir verbinden uns über die schlimmen Geschichten miteinander, nicht die hübschen. Über die, in denen wir nicht gut dastehen, nicht moralisch gehandelt haben, versagt haben, verletzt worden sind, gescheitert sind.“
In „Leben, schreiben, atmen. Eine Einladung zum Schreiben“ soll die eigene Geschichte anhand von Schreibimpulsen als erzählenswert erfahren werden und zum Schreiben anregen. „Indem ich beschreibe, besitze ich die Geschichte und nicht sie mich“, sagt sie aus eigener Erfahrung. Schreiben muss man täglich und dem „inneren Kritiker das Maul stopfen“, sagt sie in einem Fernseh-Interview. Sie will ermutigen, mit allen fünf Sinnen zu beobachten und zu erinnern. Je nach Schwere des Themas sollte in 1. oder 3. Person geschrieben werden. „Schreib über Verlorenes“, „Schreib übers Tanzen“, „Schreib über das Essen in deiner Kindheit“, „Schreib über Lügen“, „Schreib über deinen Körper“ oder „Schreib über einen Geruch“ lauten einige dieser Einladungen und Schreibanweisungen.
Alles, was wir über unser Leben erzählen, ist Fiktion, alles ist Story. Was ist das für eine Geschichte, die ich mir über mich, meine Familie, meiner Erinnerungen erzähle. Das ist für Dörrie der Anfang vom Schreiben. In „Leben, schreiben, atmen. Eine Einladung zum Schreiben“ gibt sie auch sehr persönliche Einblicke, die sie durch ihre Geschichten doch gut zu schützen weiß. Mit ihren Studentinnen und Studenten auf der Filmhochschule unternimmt sie Reisen, auch mal eine Wanderung in den Karpaten, und schafft Bedingungen und stellt ungewöhnliche Situationen her, die zum Schreiben anregen sollen. Schreiben vergleicht sie auch salopp mit dem alchemistischen Prozess „aus Scheiße Gold zu machen“.
„Ah, bullshit, sagte die Meisterin herzhaft. Das versteht jeder verdammte creative writing-Student falsch. Als gäbe es am Ende das Nicht-Scheitern, als wäre das Scheitern nur ein Zwischenschritt zum Erfolg. Nein! Es gibt keinen Erfolg! Verstehst du? Unsere Muse ist das Scheitern („Diebe und Vampire“). Das Scheitern gehört natürlich dazu, alle Gefühle, negativen Erfahrungen etc. sind genau dieser Schatz, die Bedingungen des Lebens und des Schreibens. Humor ist dabei das überlebenswichtige Mittel, um es zu überstehen, durchzuhalten und weiter zu schreiben: „Auch das Schlimme, was mir passiert ist, auch die Verluste, die ich erlebt habe ... in dem Moment, wo ich sie beschreibe, besitze ich sie und nicht sie mich.“