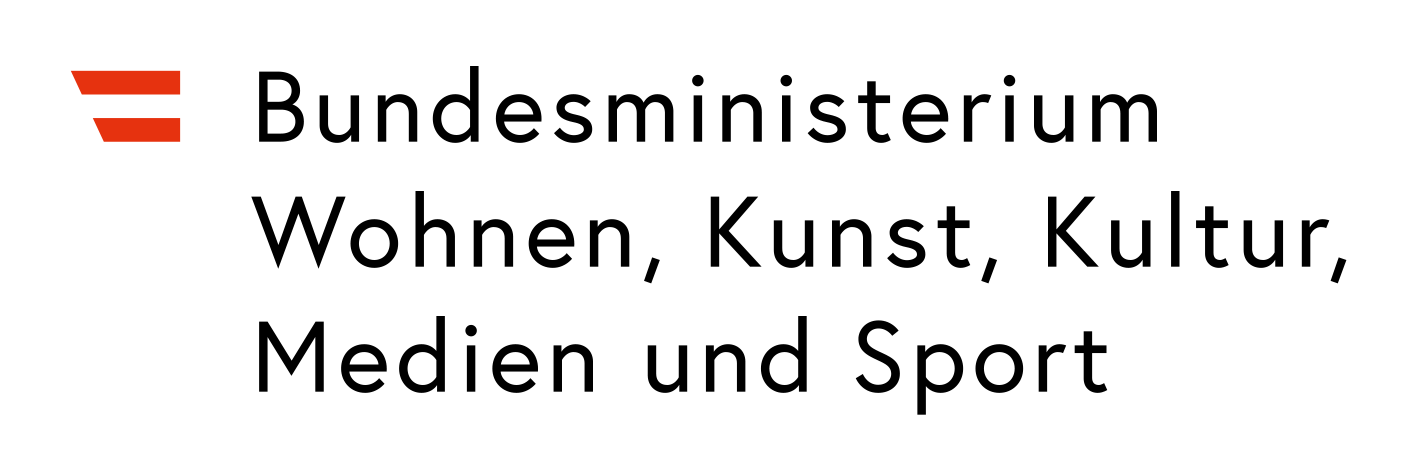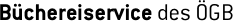Florjan Lipuš - Die Verweigerung der Wehmut

Veröffentlicht am 03.01.2024
Brigitte Winter über den slowenischen Dichter.
Florjan Lipuš gehört mit Gustav Januš zu den bedeutendsten Vertretern der Autoren aus den Reihen der Kärntner Slowenen, die ihre Werke ausschließlich in Slowenisch verfassen. 2019 erhielt er, nach einigem Hin und Her (da er eben in slowenischer Sprache schreibt), dann doch den Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur. Es sei schön, so Lipuš in seiner Dankesrede, dass diese Sprache Österreich zumutbar sei.
Geboren wurde Florjan Lipuš am 4. Mai 1937 in Lobnig bei Bad Eisenkappel im südlichen Teil Kärntens als Sohn zweier Kärntner Slowenen. Sein Vater musste während des Zweiten Weltkriegs in der deutschen Wehrmacht dienen. Als Sechsjähriger verlor er seine Mutter, als sie, nachdem sie eine als Partisanen verkleidete Gruppe von Gestapo-Männern bewirtet hatte, verhaftet und in das KZ Ravensbrück deportiert und dort ermordet wurde. Nach dem Krieg besuchte er das kirchliche Gymnasium in Tanzenberg, von 1958 bis 1962 folgte ein Studium am philosophisch-theologischen Seminar in Klagenfurt, das er jedoch nicht abschloss. Von 1966 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999 war er als Lehrer an mehreren Kärntner Volksschulen tätig.
In einem „Graben“ (wie die Einheimischen sagen), also in einem engen Tal der Karawanken als Kärntner Slowene aufgewachsen, wird er die Erlebnisse und Erfahrungen jener frühen Jahre später fiktiven Figuren zuschreiben (etwa einem Knaben namens Tjaž). Vor allem auch die Demütigungen und Repressalien der Mehrheit gegenüber den slowenischsprachigen Kärntnern, die nun längst eine Minderheit im eigenen Land sind (etwa noch 15.000 Slowenen leben in Österreich). Lange wurden sie mit misstrauischen Blicken betrachtet und waren immer wieder in Schüben den Benachteilungen und Nachstellungen ausgeliefert (am schlimmsten in der Nazizeit).
DER ZÖGLING TJAŽ
In seinem ersten großen Roman „Zmote dijaka Tjaža“ (1972, „Der Zögling Tjaž“), bereits 1972 im jugoslawischen Slowenien veröffentlicht und erst 1981 in deutscher Übersetzung in Österreich erschienen, in dem er die Geschichte eines Internatsschülers erzählt, geht es naturgemäß um die Geschehnisse aus seiner Kindheit in dem lichtarmen Graben. Vor allem um das Schicksal der Mutter, die Magd gewesen ist, oder des Vaters, der Holzfäller war, wortkarg, grob, ein Analphabet, genau so wie der Vater von Florjan Lipuš.
Wie soll man das Grauen aus der Kinderzeit beschreiben? Die Misshandlungen, die Deportationen? Gestapomänner gingen, als Partisanen verkleidet, in den Gräben von Hof zu Hof, Brot erbettelnd für die Partisanen, die „Waldleute“. Lipuš‘ Mutter, der Vater war im Krieg, fiel darauf herein. Am folgenden Tag kamen die Männer zurück. „Ich weiß noch, sie sagte, sie muss mit den Herren runter auf die Gendarmeriestation, aber sie komme bald zurück“, erzählte Lipuš. Sie band nur rasch die Schürze ab, dann ging sie fort. Da ist er sechs Jahre alt gewesen.
„Hitler war auch hinter der Mutter her, zum Glück war in den KZs noch etwas Platz, daher hat er sie einem KZ zugeteilt, dort hat sie noch einen freien Platz ergattert, einen von den letzten“, so Florjan Lipuš. Und: „Es kam eine lange, böse Zeit, gestopft mit Hunger, Kälte und Toten. Der Vater kehrte zurück, krumm und ausgezehrt, der Krieg hat ihm aus den Augen gestarrt, mit der Mutter hatten sie sich ein kirchliches Begräbnis gesichert gehabt, aber die Mutter hat das nicht mehr benötigt, denn sie verbrannte im KZ-Feuer.“ Nein, sagt Lipuš, er wisse nicht, wie sie starb, ob sie vergast wurde: „Ich habe nicht nachgeforscht. Ich habe das verdrängt.“ 57 von den rund 200 Bewohnern des Grabens sind in der NS-Zeit eines gewaltsamen Todes gestorben.
Tjaž wird nach Kriegsende Zögling in einem Priesterseminar. Nur hier konnte einer wie er überhaupt studieren, einer wie Lipuš (auch einer wie sein Mitzögling Peter Handke): ein Slowene, der hinaus will aus der Enge der Kärntner Welt. Lipuš: „Wahrscheinlich fiel es dem Tjaž unter allen Internatlingen noch am leichtesten, der Hausordnung nachzuleben, die unerbittlich tierische Unterwerfung gefordert hat. Tjaž hat sie leidenschaftlich beherrscht, hatte er doch zu Hause ihre Grundregeln mitgekriegt; die Knotenrute des Vaters hatte ihm auf eine sehr nachdrückliche Weise die ersten Gesetze des Kadavergehorsams ins nackte Fleisch eingeprägt.“
Tjaž rebelliert, er kratzt an den ehernen Zuständen; da wird er gestraft, verstoßen, in den Selbstmord getrieben. Auch Florjan Lipuš rebelliert. Er will nicht Priester werden, sondern arbeitet dann als Lehrer, anfangs im heimischen Graben. Nebenbei beginnt er zu schreiben, ein paar Stunden vor Unterrichtsbeginn. Lipuš im unauffälligen Gewand des Dörflers, ein Schulmeister, dem es peinlich wäre, vor ihnen Schriftsteller genannt zu werden. Schreiben sei bloß ein Hobby: „Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, es dränge aus ihnen heraus. Aus mir drängt nichts heraus, bei mir geht alles sehr zaghaft. Ich verspüre keine messianischen Anfälle.“
Seit 1961 hat er (gemeinsam mit Karel Smolle und Erik Prunč) die Literaturzeitschrift „Mladje“ („Jungholz“) herausgegeben, Sprachrohr der jungen zweisprachigen Autoren und Autorinnen. Jahrzehntelang hat Florjan Lipuš sich stark gemacht für seine Sprache, seine Kultur, sein Volk. Nach zwanzig Jahren zieht er sich zurück. Er will nicht mehr für Nachbarn sprechen, die Fürsprache nicht wünschen, meint er. Und nicht länger in Sippenhaft genommen werden für den Zufall oder den Fluch der Geburt. Und er will nicht mehr Repräsentant sein, sondern nur noch Individuum: „Wir stellen uns als Exoten dar. Unsere Organisationen wollen Sprache und Kultur zwanghaft erhalten. Doch das Niveau ist jämmerlich. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Warum drängen wir uns so auf? Das geht ja allen auf die Nerven!“
1980 kehrt Peter Handke, der Kosmopolit, nach Südkärnten zurück, möchte seine Muttersprache auffrischen und greift dabei als „Übungstext“ zum „Zögling Tjaž“ von Florjan Lipuš. Handke rühmte die „Wortspielkunst“ des Kollegen sowie „die Wucht und den Schmerz“ seiner Texte. Die deutsche Übersetzung wurde 1981 in Wien in Anwesenheit des Autors, der beiden Übersetzer und von Bundeskanzler Bruno Kreisky präsentiert. Für die Übersetzung (gemeinsam mit Helga Mracnikar, 1981 im Residenz Verlag erschienen) gibt es viel Anerkennung, für Handke und im Gefolge auch für den Verfasser. Mit einem Schlag werden seine Texte (und die anderer Kärntner Slowenen) vom Literaturbetrieb wahrgenommen.
DIE VERWEIGERUNG DER WEHMUT
Schon seine frühen Texte sorgen für Aufregung. Mit dem Erfolg des Erstlings, ab Beginn der 80er Jahre, schreibt Florjan Lipuš eine Handvoll weiterer Bücher, abgründige Dorfgeschichten jenseits jeder Heimattümelei, expressionistisch gefärbte Texte über Sterben und Tod und über den Zerfall von Volksgruppen und Traditionen.
In seinem zweiten Buch „Odstranitev moje vasi“ (1983, „Die Beseitigung meines Dorfes“) setzt er auf eine unkonventionelle Form. Hier gibt es weder individualisierte Figuren, noch eine durchgehaltene Handlung. Es geht um ein Dorf, das so schemenhaft bleibt wie seine Bewohner, ein Reigen namenloser Funktionsträger: „die Bäurin“, „der Bestatter“, „der Pfarrer“, „die Honoratioren“. Im Verlauf von acht Kapiteln werden verschiedene Ereignisse des Dorflebens geschildert, die allesamt von grotesken Ritualisierungen gekennzeichnet sind. Der Kollektivcharakter der Dörfler ist bösartig, als Abwechslung vom Einerlei wird von allen ein Todesfall herbeigesehnt. Man sieht die Nachbarn mit nekrophilem Blick daraufhin an, ob sie nicht bald fällig sind: „Die Erde reißt vor Dürre ihren Rachen auf, nach Leichen lechzt das Dorf.“ Naturgemäß steckt das Dorf „tief im Katholizismus“, und so sind es vor allem die Prozeduren der Kirche, die Anlass zu skurrilem Spott geben. Menschliches Erleben bleibt durchgehend ausgeklammert. Lipuš erzählt die Dorfgroteske in einem eigenwilligen Stil, der in karnevalistischer Form Sprichwörtliches, Deftiges aus der dörflichen Alltagssprache, zahlreiche Wortspiele, Reime und eine pathetische Metaphorik zusammenmischt. Anders als in den meisten Dorfromanen wird hier nicht in psychologischer, sondern in soziologischer Perspektive erzählt und ein modellhaftes Bild vom Leben am Land entworfen.
In „Jalov pelin“ (1985, „Die Verweigerung der Wehmut“) ist der Vater gestorben, und der Sohn, der sich längst in der Stadt ein Leben aufgebaut hat, kehrt für die Beerdigung in die Berge zurück. Da liegt der Alte, aufgebahrt, und die Dorfgemeinschaft kommt, sich zu verabschieden. Der Tod ist hier kein Abstraktum, sondern von archaischer Präsenz, ist Gewohnheit und Ereignis zugleich. So wird die Totenwache, die den Alten hinübergeleitet, zum Fest für die Lebenden. Alles drängt sich da zum Beten im Zimmer, aus dem Speisekeller wird das Beste hervorgeholt, wo sonst das Essen spärlich ist, und die Männer schnipsen etwa Papierkügelchen nach den Frauen. Florjan Lipuš lässt die raue Liturgie eines Abschieds aufwallen, der längst vollzogen ist und ruft doch die Schrecken einer kargen Kindheit in den Karawanken auf, in die der Zweite Weltkrieg mit unerträglicher Härte sich eingetragen hat. Trauer um den Toten und ein Fest fürs Leben fallen in eins. Mit ironisch-abwehrender Geste, bisweilen mit Zynismus, nimmt sich Lipuš volkstümlicher Erzählformen an, der Abendgeschichten, Kalendergeschichten. Rituell klingt sein Stil, aber nur zum Schein. Er spielt mit der archaischen Melodik des Slowenischen, zerbricht sie, er schlägt einen Pfad durch das wuchernde Sprachgestrüpp, Lipuš, ein Ketzer? Eine „Fabel“? Die sucht man in seinen Prosastücken oft vergebens. „Sammelsurium an sprachlichen Einfällen“ etwa nennt er diese essayhafte Form.
In „Stesnitev“ (1995, „Verdächtiger Umgang mit dem Chaos“) kommt ein Erzbischof im Jahre 1670 in die Pfarre Kappel, ins enge Karawankental, um nach dem Rechten zu sehen. Abends entdeckt er im Bett eine aufs Kreuz genagelte schwarze Katze: Kein Kirchlein, wo nicht auch der Teufel seine Kapelle hat. Den Vorfall untersuchen soll der Abgesandte des slowenischen Aufklärers und Beschreibers der Herzogtümer Krain, Valvasor. Keiner entkommt dem Andern: Den jungen Gelehrten erwarten die Beengtheiten von Kappel sowie Bedrängnisse seines Herzens. Vitezovic‘ Traktat über Rechtssprechung in Kärnten, dessen detaillierte Darstellung, von der Beschreibung der Gerüche alten Schweißes bis zur Feststellung, die Leute sprechen hier auf zwei Arten, brachten ihm große Anerkennung. Florjan Lipuš gelang hier ein einzigartiger, bildreicher und scharfsinniger Roman.
BOŠTJANS FLUG
„Boštjanov let“ (2003, „Boštjans Flug“) könnte ein trauriges Buch sein, es ist jedoch ein durchaus lebensfrohes Buch. Es ist der Roman einer slowenischen Kindheit und Jugend, die unauslöschlich von Verlust geprägt wird. Die wichtigsten Stationen der Geschichte, die sich räumlich und zeitlich miteinander verflechten, verbinden sich letztlich zu einem erschütternden, faszinierenden Ganzen. Geschildert wird die Verschleppung und Deportation der Mutter und ihr Tod im Konzentrationslager, während der Vater in der Deutschen Wehrmacht dient, die Heimkehr und zweite Heirat des Vaters, die in mythisch-magische Dimensionen reichende Welt der sterbenden Großmutter und die Einsamkeit und Trauer des jugendlichen Boštjan sowie seine rettende Begegnung mit der ersten Liebe.
Dieses elegische, zornige, verzagte, verzaubernde, wütende, ironische, traurige und herzzerreißende Buch ist, so Lothar Struck, ein Sprachkunstwerk von phantastisch-bizarrer Schönheit. Etwa so, wie Boštjan seiner Lina einmal eine Distel für den Heimweg schenkt, so wird der Leser hier beschenkt. Kongenial anmutig sind die Bilder aus dem Slowenischen ins Deutsche von Johann Strutz nicht nur übersetzt, nein, eingewebt und eröffnen einen betörenden, zuweilen gänzlich neuen Sprachkosmos. Ein junger Mann trifft sein Mädchen: „Sie gingen zu zweit ins Helle, in den Tag, der sich für sie breit machte.“ Peter Handke nannte „Boštjans Flug“ in seinem Nachwort „das erste Buch der Liebe seit (fast) unvordenklichen Zeiten in unseren europäischen Breiten und Längen und vor allem Engen“.
SEELENRUHIG
In dem kleinen Buch „Mirne duše“ (2017, „Seelenruhig“) bringt Florjan Lipuš auf hundert Seiten nicht nur ein ganzes Leben, sondern vor allem das Leben als Ganzes unter. Von den ersten Wahrnehmungen, den Nöten des Aufwachsens und den Schwierigkeiten, sich in der Welt der anderen zurechtzufinden, über die ersten Glücksmomente der Begierde und der Liebe bis zu dem letzten Blick der Augen auf eine Welt, die man, auch wenn sie nicht immer verlockend ist, doch nur ungern verließe. Er berichtet vom Aufwachsen in bäuerlicher Umgebung, in einer Familie, die von den Entsetzlichkeiten der Geschichte nicht verschont wurde und erzählt vom Aufwachen unter den verstohlenen Blicken einer jungen Frau, mit der er noch als Alter das Leben teilt.
Mitunter passieren merkwürdige Dinge: „Wenn er sich in der Nacht gegen Morgen im Bett umdrehte und die Augen öffnete, stoben Funken aus den Fingernägeln, kurze kleine Blitze jagten mit kaum hörbarem Pfeifen und Zischen aus den Hautgrübchen, ähnlich dem verzerrten Gesang einer Zikade, wenn sie erstmals ihre Stimmplättchen erprobt.“ Immer wieder treibt ihn dasselbe Problem um: „Ein Mensch, der jahraus, jahrein, sommers und winters ein und dieselbe Erde bearbeitet. Ein Wanderer, der von dem steinigen Grund ein und dasselbe einzige Gestein aufliest und sammelt. Ein Schriftsteller, der sein ganzes Leben an ein und demselben einzigen Text schreibt.“
Vieles bleibt in dieser Erzählung geheimnisvoll, denn der Vater, ein Holzfäller, dem sich der Sohn nähern möchte, spricht nicht, er zieht das Schweigen vor; die handwerkliche Arbeit ist ihm wichtiger als das Sprechen. Die Mutter, eine Magd, ist für immer verschwunden, ihr Tod bleibt im Dunklen, wirkt wie eine ständige Bedrohung. Der Beichtstuhl in der Kirche ist ein Ort verschwiegener Bekenntnisse, denen man vergeblich zu lauschen versucht und das alte bischöfliche Internat aus der Jugendzeit erinnert an Pein und Bedrückungen. Das Leben ist umzingelt von Erinnerungen. Nicht nur Alpträume kommen hoch, es gibt auch zarte, wundervolle Momente der Liebe und Zuneigung, die im Rückblick das Leben versöhnlich machen, gehüllt in eine poetische Zauberkraft.
SCHOTTER
Der Schotter, den Florjan Lipuš in seinem bislang letzten Buch („Gramoz“,2019, „Schotter“) beschwört, bedeckt die ansonsten leere Fläche zwischen den Baracken eines Frauenkonzentrationslagers. Es könnte das KZ Ravensbrück sein, wo seine Mutter ermordet wurde, nachdem sie die als Partisanen verkleideten Gestapo-Männer bewirtet hatte. Es könnte aber auch jedes andere Lager sein, wo die aussortierten, ausgemergelten Frauen Stunde um Stunde ihres schwindenden Lebens Appell stehen müssen.
Viele Jahre später stehen hier dann die „Gedächtnisgeher“, „Ausflügler“ nachfolgender Generationen auf der Suche nach etwas, von dem es kaum noch Spuren gibt, in der Hoffnung, dass sich ihnen etwas offenbart. Die unbekannte Großmutter etwa: Sollen die Enkelkinder, die ihr die schön gewachsenen Körper verdanken, sie duzen oder siezen? Doch die Großmutter erscheint ihnen nicht, alles, was sie finden, ist Schotter. Und im Dorf, in das sie zurückkehren, begegnet man ihnen wieder mit Misstrauen und Schweigen. Erzählt wird, wie die Erinnerung, die vergangenen Schrecken verloren gehen im Dreieck von Kirche, Friedhof und Gasthof, in der lustvollen Einkehr in den Moment und der Sehnsucht nach früher. Die Dörfler werden zu einem uniformen, gefügigen Volk der „glatten Köpfe“.
Florjan Lipuš geht es dabei weniger um eine Handlung als um das Finden einer Sprache für das Unsagbare und das Speichern verblassender Erinnerungen: „Bleiben wird, was über sie erzählt wurde. Der Körper vergeht, die Erzählung besteht, sie löst sich aus dem Körper und lebt auf.“
Foto (c) Marko Lipuš