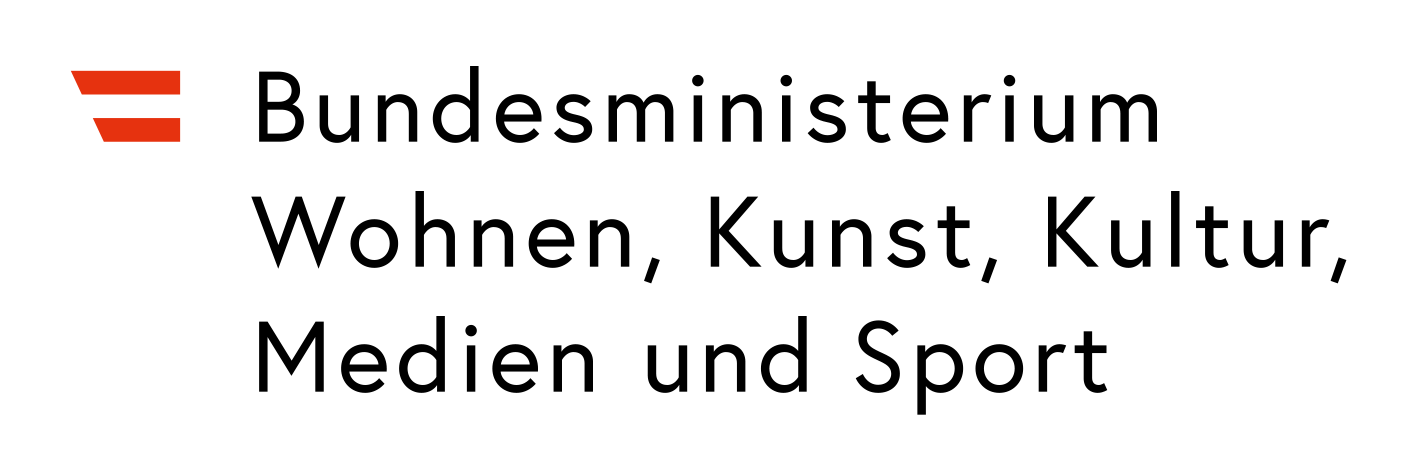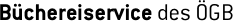Helga Schubert - Ich tarne mich mit Einfachheit

Veröffentlicht am 13.06.2023
Christine Hoffer über Helga Schubert.
Helga Schubert schreibt seit etwa sechzig Jahren, ihren ersten Erzählband veröffentlichte sie 1975 – und trotzdem kannte sie, bevor sie 2020, als 80-Jährige den Bachmannpreis gewann, kaum jemand. Lange war sie fast vergessen. Durch den Bachmannpreis wurde die große Erzählerin von kleinen Geschichten zu Recht wiederentdeckt und ihre Bücher, die teils wiederaufgelegt werden, sind seither Bestseller.
Geboren wurde sie als Helga Helm (Helga Schubert ist ein Pseudonym) am 7.1.1940 in Berlin-Kreuzberg, nach dem Krieg landete sie mit ihrer Mutter in Ost-Berlin. Dort wuchs sie in bescheidenen Verhältnissen auf, weil ihre Mutter, eine Bibliothekarin, alles Geld in Bücher steckte. Nach dem Abitur arbeitete sie ein Jahr als Montiererin, studierte Psychologie, heiratete, bekam ein Kind und verpasste nach eigenen Aussagen „eine der letzten S-Bahnen nach Westberlin vor dem 13. August 1961 und war so eingezäunt wie meine Millionen Mitbürger im Osten“. Nach ihrem Diplom arbeitete sie als klinische Psychologin in der Erwachsenen-Psychotherapie sowie als Fachpsychologin der Medizin und als Ausbildnerin in Gesprächstherapie und in der Eheberatung. Aus dieser Zeit stammen ihre ersten Schreibversuche. 1970 legte sie dem Aufbau Verlag eine Sammlung ihrer Gedichte vor. Veröffentlichen wollte man ihre Lyrik zwar nicht, aber die Verlagsmitarbeiter ermutigten die junge Psychologin weiterzuschreiben. Sie stieg dann auf Kurzgeschichten um, ein Genre, das bis heute ihr liebstes bleiben sollte. Der Zufall führte sie knapp ein Jahr später mit Sarah Kirsch zusammen, die eine Freundin und Förderin werden sollte. Kirsch leitete zu jener Zeit einen Zirkel schreibender Arbeiter und Studenten. Als Helga Schubert ihr ein paar ihrer Geschichten vorlegte, zögerte Kirsch nicht und reichte die Texte mit Empfehlung an den Aufbau Verlag weiter.
1975 erschien ihr erster Erzählband „Lauter Leben“, für den Sarah Kirsch das Nachwort verfasste. In 31 Kurz- und Kürzestgeschichten hält sie hier Begebenheiten aus dem DDR-Alltag fest. Mit wenigen Strichen zeichnet sie Frauenschicksale aus allen sozialen Schichten nach und filtert aus vielfach beobachteten, immer nach den gleichen Mustern ablaufenden Vorgängen und Situationen entlarvende, manchmal ironisch wirkende Bestandsaufnahmen.
Vielfältig sind die Themen und erzählerischen Mittel der Texte: Von einer wissenschaftlichen Tagung, in der sie die leeren Phrasen der Teilnehmer karikiert, über den Besuch bei einem Modefriseur, einem Maler und einer Töpferin, der ironisierenden Zeichnung des „Touristik-Syndroms“ von DDR-Urlaubern in Rumänien bis zur beißend-satirischen Beschreibung der Bestellpraxis eines Polyklinikers reichen die Schauplätze und Themen. Es sind Einzelschicksale, von Frauen: von Resi, einer Haushaltshilfe, die in ihren „kleinbürgerlichen“ Verhaltensweisen steckengeblieben ist, so dass ihr das kostenlose Mittagessen immer noch die Hauptsache ist, obwohl sie inzwischen Geld hat und es verschwenderisch ausgibt; die Geschichte von „Tante Ellis Nachkriegslist“, durch die sie es schafft, den einquartierten Besatzungsoffizier durch Kartenlegen zu umgarnen, um an Kaffee und Alkohol zu kommen; oder von der Polin Anna, die an Touristen vermietet, nebenbei einen schwunghaften Handel betreibt, aber im Krieg Partisanin war. Allein durch ihre distanzierte Sprache übt sie Kritik an den beschriebenen Sachverhalten. „Ich tarne mich mit Einfachheit“, bekannte sie einmal in einem Interview.
Helga Schubert interessiert sich seit jeher für das Alltägliche und greift in ihren Texten Geschichten auf, die sie von Freunden und Bekannten gehört hat, häufig sind Frauen im mittleren Alter, so wie ihre Protagonisten. Sie schreibt etwa über jungfräuliche Kriegswitwen, über eine Haushälterin, die sich tapfer durchschlägt, über verzwickte Affären oder die lieblose Ehe ihrer Nachbarin. Sie schreibt über ganz normale Menschen. Menschen, die manchmal einfach nicht mehr weiterwissen. Aber sie wird dabei nie zur Schaulustigen, vielmehr hat die Erzählerin in ihren Texten ein ehrliches Interesse daran zu erfahren, was mit einem los ist. Die Tragik des Alltags spiegelt sich im Ungesagten, zwischen den Zeilen. So heißt es zu Beginn der Geschichte „Meine alleinstehenden Freundinnen“: „Meine alleinstehenden Freundinnen kann man unangemeldet besuchen. Meistens ist schon jemand da. Man kann zu ihnen jemand mitbringen. Meine alleinstehenden Freundinnen kommen nie unangemeldet, und wenn sie vorher von der Ecke anrufen. Sie wollen, dass man dann allein ist. Sie bringen niemand mit.“
In ihrem zweiten Prosaband „Das verbotene Zimmer“ (1982) versucht sie, dem Lebensgefühl dieser Generation Ausdruck zu verleihen. Die eigene Person viel stärker einbeziehend, handeln diese Geschichten, „die irgendwo zwischen Erzählung, literarischer Reportage und Selbstreflexion angesiedelt“ sind (so Michael Töteberg), von enttäuschten politischen Hoffnungen, vom Rückzug des Einzelnen in private Räume und von Emanzipationsbestrebungen, die sich gegen jegliche Fremdbestimmung richten. Die Aussagen der oft autobiografisch gefärbten Texte werden durch die nüchterne Sprache aus dem Bereich des rein Persönlichen herausgehoben. In der Titelerzählung „Das verbotene Zimmer“ berichtet die Ich-Figur von einer wiederholt im Traum und schließlich in der Realität erlebten Reise von Ost-Berlin in den Westen der Stadt. Die Beobachtungen in West-Berlin veranlassen die Ich-Erzählerin zu kritischem Nachdenken über die systembedingten unterschiedlichen Lebensformen und Verhaltensweisen der Menschen. Auf ihr Erzähltalent wurden bald auch ihre Schriftstellerkollegen aufmerksam. 1975 wurde sie von Martin Stade, Klaus Schlesinger und Ulrich Plenzdorf eingeladen, an ihrem Anthologie-Projekt „Berliner Geschichten“ teilzunehmen. Die Herausgeber wollten im Plenum mit den Autoren selbst bestimmen, wer mit welchem Text vertreten ist, und es einem DDR-Verlag zur unkorrigierten Drucklegung anbieten – zu jener Zeit unvorstellbar und für die DDR-Führung Anlass genug, nicht nur das Vorhaben zu verhindern, sondern auch Herausgeber und Autoren zur „Aussprache“ im Schriftstellerverband vorzuladen. Dort weigerte sich Helga Schubert, ihren Beitrag mit dem Titel „Heute abend“ zurückzuziehen, weil er parteikritische Töne enthalte (unter anderem ist von einer Frau die Rede, die „es eben satt gehabt“ und sich das Leben genommen hatte). Seitdem hatte sie ständige Begleiter. Die Stasi observierte sie bis 1989.
Auch dass sie die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 und die darauf folgenden Ausschlüsse von Autoren aus dem Vorstand des Schriftstellerverbands kritisierte und neben Elke Erb, Brigitte Struzyk und Bettina Wegner auf Veranstaltungen der Evangelischen Kirche auftrat, gefiel der DDR-Regierung nicht. Als sie 1980 nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb eingeladen wurde (sie sollte dort also schon vor vierzig Jahren lesen), verwehrte man ihr die Ausreise. Erst in der Endphase der DDR durfte sie nach Klagenfurt reisen, doch diesmal nicht als Autorin, sondern von 1987 bis 1990 als kundiges Mitglied der Jury. Auch den Fallada-Preis der Stadt Neumünster durfte sie 1983 nicht entgegennehmen. Umso erstaunlicher ist es, dass die meisten von ihr zu DDR-Zeiten veröffentlichten Erzählbände zuerst im Luchterhand Verlag in der BRD erscheinen konnten. Das geschah mit offizieller Genehmigung, aber die Bedingung war, dass der Staat finanziell vom Verkauf der Bücher im Westen profitierte, während Schuberts Honorar eins zu eins von D-Mark in DDR-Mark umgerechnet wurde, womit so gut wie nichts übrig blieb. Helga Schubert war auch nie Mitglied in der SED, eine sozialistische Grundhaltung hatte sie nicht. Nach der Wende machte sie öffentlich, dass sie zu DDR-Zeiten lieber in den Westen gegangen wäre. Dass sie geblieben ist, hing in erster Linie mit ihrem Mann Johannes Helm, einem Psychologie-Professor und talentierten Amateurmaler, zusammen und auch mit einem alten Fachwerkhäuschen im mecklenburgischen Neu Meteln.
Im Sommer 1975 verbrachte sie mit ihrer Familie auf Einladung von Christa Wolf zum ersten Mal die Ferien in der Gegend. Das Ehepaar Wolf und Schubert/Helms hatten sich über Wolfs Tochter Annette kennengelernt, die bei Johannes Helm studierte, und waren seitdem in Kontakt. Christa Wolf hatte Helga Schubert ein Ferienhaus ganz in der Nähe zu ihrem eigenen Bauernhaus besorgt. Die Gegend gefiel der Familie so gut, dass sie noch im selben Jahr das rohrgedeckte Fachwerkhaus gegenüber den Wolfs erwarben und fortan jeden Urlaub dort verbrachten. Auch die anderen in der Umgebung ansässigen Autoren lernten sie näher kennen. In jener Zeit hatte sich in diesem abgeschiedenen Winkel zwischen Schwerin und Wismar eine Art Schriftstellerkolonie entwickelt. Die Städterin Helga Schubert betrachtete das Bauernhaus als einen „Rückzug innerhalb der DDR“.
Als das Haus im Juli 1983 gemeinsam mit dem Wolf’schen Büdnerhaus abbrannte, hoffte Helga Schubert zunächst, nun einen Schlussstrich ziehen und in die BRD ausreisen zu können. Doch da sich ihr Mann nicht von der Landschaft und sie sich nicht von ihm trennen konnte, entschied sich das Ehepaar dazu, das Haus an selber Stelle wiederaufzubauen. Die Wiedervereinigung begrüßte sie vorbehaltlos. Den Aufruf „Für unser Land“, in dem sich einige namhafte Schriftstellerkolleginnen und -kollegen zum Sozialismus bekannten, unterschrieb sie nicht – sie wollte keine andere DDR, sie wollte keine DDR.
Das Buch „Judasfrauen“, mit zehn Fallgeschichten über weibliche Denunziation im Dritten Reich, durfte in der DDR nicht erscheinen und wurde erst 1990 publiziert. Damit berührte sie ein bis dahin vernachlässigtes und verdrängtes Thema: In zehn Lebensläufen beschreibt sie das jeweilige Umfeld und den jeweiligen Werdegang von Denunziantinnen in der Zeit des Nationalsozialismus. Parallel dazu reflektiert sie ihre vierjährigen Recherchen, unter anderem im Zentralen Parteiarchiv in Ost-Berlin. In einer Annäherung an die Judasfrauen versucht sie, das Phänomen des Verrats zu analysieren, ohne jedoch die Frage der Schuld beantworten zu wollen.
In Schuberts Erzählhaltung spiegeln sich auch ihre eigenen Gemütsbewegungen (Trauer, Wut, Abscheu) wider, die sie beim Erzählen und Niederschreiben der Ereignisse durchlebte. Den Empfindungen der Verräterinnen vor und nach der Denunziation möchte sie auf die Spur kommen. Gleichzeitig stellt sie die Frage, warum so viele Frauen am Verrat beteiligt waren: „Von Männern verhaftet, von Männern verhört, von Männern verurteilt, von Männern geköpft. Aber von Frauen verraten.“ Vielfach kannten die Frauen ihre „Opfer“, die auch allein aufgrund einer kritischen Äußerung hingerichtet wurden. Als Motiv, sich mit den „Judasfrauen“ zu beschäftigen, nannte Helga Schubert einmal ihre Erfahrung mit der „präfaschistischen Heroisierung der Frauen in der DDR“. Sie nennt ihre Fallgeschichten Parabeln, „Parabeln des Verrats“, wobei sich ihr Interesse auf die „Auswirkungen eines totalitären Staates auf das Alltagsverhalten seiner Bürger“ richtet. Die Fälle politischer Denunziation aus der Nazizeit sind für sie damit Beispiele, die zugleich auf ihre eigene Gegenwart in der DDR verweisen.
In der wenige Tage nach dem 9. November 1989 geschriebenen Vorbemerkung kann Helga Schubert dies schon deutlich aussprechen und ihre Geschichten „verschlüsselte Botschaften“ nennen. Sie geht also einer bestimmten, gleichsam mittelbaren Täterschaft nach, dem Verrat, genauer der „Versuchung zum Verrat (...) in einer Gesellschaftsordnung, in der es möglich (ist), private Konflikte sozusagen mittels Staatsgewalt zu lösen“. Und diese spezifische Form der Täterschaft, in der die Hände der Täter rein bleiben und sie sich der Staatsgewalt bedienen, um die Opfer zu treffen, wird für sie in den Fällen weiblicher Denunziation verkörpert: in den „Judasfrauen“. Somit hat der Verrat für sie ein weibliches Gesicht: „Judas als Frau“.
Im Umfeld ihrer Auseinandersetzung mit den „Judasfrauen“ stieß Helga Schubert auf umfangreiches Aktenmaterial über Euthanasieopfer des Nationalsozialismus, das in der DDR bis 1989 unter Verschluss gehalten wurde. In dem Band „Die Welt da drinnen“ (2003) deckte sie auf, dass Patienten aus einer Klinik in Schwerin, die als „geisteskrank“ behandelt worden waren, von nationalsozialistischen Ärzten 1941 als „lebensunwertes Leben“ getötet wurden. Die Tragik des Einzelfalls nimmt sie auch zum Anlass, grundsätzlich die Frage nach möglichen Verhaltensweisen des Einzelnen in einer Diktatur zu stellen. Das Buch ist keine historische Studie, sondern ein bewegendes und einzigartiges Stück Literatur: In „Die Welt da drinnen“ erzählt Helga Schubert von der Innenwelt der „Wahnsinnigen“ und von der wahnsinnigen Außenwelt ihrer Ärzte und Pfleger.
VOM AUFSTEHEN
2020, im Alter von 80 Jahren, wurde sie auf Vorschlag von Insa Wilke erneut zur Teilnahme am Bachmann-Preis eingeladen und wurde damit zur ältesten Teilnehmerin des Wettbewerbs überhaupt, den sie schließlich mit ihrem Text „Vom Aufstehen“ auch gewann. Der Text sei eine Hommage an Ingeborg Bachmanns Erzählung „Das dreißigste Jahr“, die mit einer Reflexion über das Aufstehen beginnt und die den Protagonisten am Ende zum Aufstehen auffordert („Ich sage dir: Steh auf und geh! Es ist dir kein Knochen gebrochen“), erklärte Helga Schubert in ihrer Dankesrede. Ursprünglich hätte sie den Text, anspielend auf ihr eigenes Alter und Ingeborg Bachmanns Text, „Das achtzigste Jahr“ nennen wollen, habe die Idee dann aber verworfen. Die Erzählung setzt sich mit der problematischen Beziehung einer Tochter zu ihrer durch den Krieg hart gewordenen Mutter auseinander.
Als dann im Frühjahr 2021 nach 18 Jahren mit „Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten“ endlich wieder ein neues Buch von Helga Schubert erschien, war es das Comeback des Jahres. Der Roman in 29 Erzählungen berichtet in lakonischem Tonfall über die verschlungene Biografie der Autorin. Es ist ein Jahrhundertleben.
Helga Schuberts Mutter erklärt ihrer Tochter: Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht. Sie habe sie nicht abgetrieben, habe sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und habe sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt sie ein deutsches Leben im vorigen Jahrhundert – ihre Geschichte, zugleich Fiktion und Wahrheit. Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es die Geschichte einer Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und sich selbst.
Sie behandelt ihren hier in Einzelgeschichten angeblendeten eigenen Lebensstoff aus der Distanz einer Beobachterin, die nicht in der Gefahr steht, in Selbstbeweihräucherung abzugleiten, denn wann immer sie „Ich“ sagt, tut sie dies mit dem abgeklärten Blick der Älteren auf die jüngere Version ihrer selbst. Als Kriegskind hat sie Flucht und Vertreibung erlebt, verlor früh den Vater an der Front – und suchte fortan ihren Platz in der Familie und in der Welt. Mal bei der eigensinnigen Mutter, mal bei der ihr Geborgenheit spendenden Großmutter. Den Zweiten Weltkrieg, die deutsche Teilung, den mühsamen Alltag in der DDR, die Staatssicherheit und die Wende 1989: All das macht Helga Schubert in ihren Texten noch einmal für sich und uns begreifbar – betrachtet durch das Brennglas ihrer eigenen Biografie. Sie zeigt, ohne zu werten. Lässt das Erzählte für sich selbst sprechen: „Etwas erzählen, das nur ich weiß. Und wenn es noch jemand liest, weiß es noch jemand. Für die wenigen Minuten, in denen er die Geschichte liest. In der unendlichen, eisigen Welt.“
Am Ende ist es auch so etwas wie eine Chronik der Vergebung – hatte die Mutter ihre Tochter doch jahrelang mit bösartigen Sprüchen gequält, indem sie immer wieder vorgab, sie habe sie eigentlich abtreiben wollen, habe später, auf ihrer Flucht vor der russischen Armee, geplant, ihre kleine Tochter irgendwo alleine zurückzulassen und spielte sogar mit dem Gedanken, die kleine Helga angesichts der anrückenden Russen zu vergiften. Wie, so fragt man sich, kann eine Tochter einer derart grausamen Mutter später ohne Verachtung begegnen und sie sogar lieben? Helga Schubert gelingt es, ihrer in ihren Texten wiederholt auftretenden Mutter zu vergeben, indem sie diese vor dem Hintergrund der damals herrschenden Umstände zu verstehen versucht. Aber eben erst nach dem Tod der Mutter. So scheinen die in ihrer Kindheit erlebten Schrecken formal gebannt, in den Texten selbst aber bleiben sie spürbar. Die miteinander verbundenen Erzählungen lassen sich durchaus auch als ein berührendes Trostbuch lesen. Nicht nur von den Leserinnen und Lesern geliebt, sondern durchweg auch von der Kritik gelobt, ja geradezu hymnisch besprochen, stand „Vom Aufstehen“ lange auf der „Spiegel“-Bestsellerliste und wurde über 200.000 Mal verkauft.
Verheiratet mit dem Maler und früheren Professor für Klinische Psychologie, Johannes Helm lebt Helga Schubert seit 2008 nun ganz in Neu Meteln bei Schwerin. In ihrem heuer erschienenen Erzählband „Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“ hat sie ihr Leben mit ihrem pflegebedürftigen, demenzkranken Mann verarbeitet, um den sie sich kümmert. Statt ihren Mann die letzte Lebenszeit im Hospiz verbringen zu lassen, kümmert sie sich aufopferungsvoll und schreibt berührend über die Mühen und Freuden dieser Aufgabe. Sie erzählt dabei von einem alten Liebespaar. Das Ich ist sie selbst, und doch eine literarische Figur. Der Mann ist ihr Mann, und doch verfremdet: „Wann kommt sie wieder, fragt er mich, fragt mich der, den ich so liebe: Ich nenne ihn Derden. Ich habe den Namen gegoogelt: Es gibt ihn noch nicht. Derden fragt mich nach mir, denke ich erschrocken, er erkennt mich nicht.“ Ein Paar sind sie seit 58 Jahren, 47 Jahre davon verheiratet. „Hast du schon einmal meine Bilder gesehen?“, fragt er. „Ja, ich war bei jedem Bild dabei, das du gemalt hast.“ In Rückblicken erzählt sie vom Anfang ihrer Liebe. Auf der Gegenwartsebene setzt Helga Schubert fort, was man aus „Vom Aufstehen“ kennt: die meist positiv gestimmte Schilderung des Alltags an der Seite eines Schwerstkranken. Weder Zurückweisungen durch andere, noch Unfälle ihres Mannes können sie niederdrücken.
So viel Liebe auch vorkommt, die bitteren, traurigen, harten Momente, die die Pflege eines schwer kranken Menschen mit sich bringt, lässt sie nicht aus: Menschen, die ihr vorschlagen, dem Mann Morphium zu geben oder ihn mit einem kalten Waschlappen im Gesicht morgens zu wecken. Oder die Unmöglichkeit, mal wegzufahren, weil es niemanden gibt, der sie in der Pflege ersetzen kann; ihr inneres Verbot, darüber nachzudenken, was sein nahender Tod für sie auch für Vorteile hat. Grandios beschreibt sie minutiös ihren Alltag und ihre Gefühle dazu. So geht es in diesem sehr persönlichen, intimen Buch um zutiefst Menschliches, das auch im hohen Alter noch erlernt werden kann und muss: „Das Loslassen, das Annehmen, es geht um das Friedenschließen.“
Foto: (c) Renate von Mangoldt / dtv