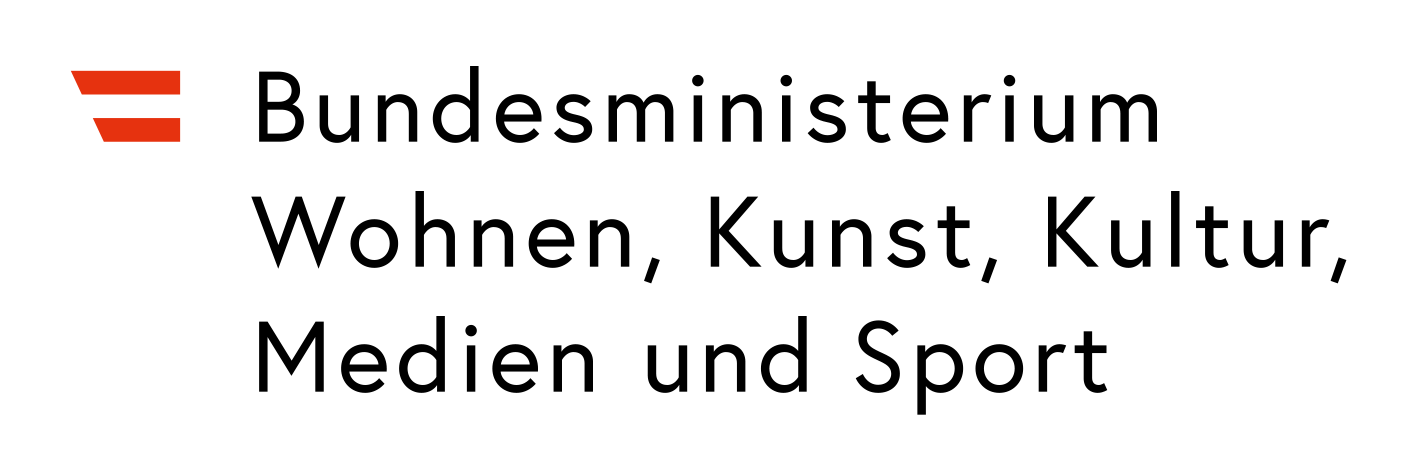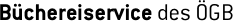Herman Melville - Hört, o Leser! Ich bin ohne Karte gereist

Veröffentlicht am 12.06.2023
Simon Berger über Herman Melville.
Als Herman Melville 1891 starb, war er in der literarischen Welt längst vergessen. In Meyers deutschem Universallexikon war er bereits 1871 für tot erklärt worden. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er langsam in Europa wiederentdeckt, so dass plötzlich vor allem der bei Erscheinen im Jahr 1851 völlig ignorierte Großroman „Moby Dick“ als der amerikanische Klassiker neben den Geschichten von Edgar Allan Poe auferstand. Heute ist er auch ein unbestrittener Schulklassiker. Aber dem Rätsel Melville kamen bis heute weder seine Bewunderer noch seine Kritiker auf die Spur.
Die beiden letzten Jahrzehnte seines Lebens (von 1866 bis zu seinem Ruhestand 1885) verbrachte der erfolglose Schriftsteller Herman Melville als Zollinspektor in Manhattan. Von seinem Haus in der East 26th Street zu den Hafenanlagen am östlichen Hudson-Ufer waren es einige Kilometer, die der Zollinspektor im Außendienst täglich zu Fuß ging. Der Zollbezirk New York besaß um 1870 mehr als zweitausend Frachtsegler, einige hundert Dampfschiffe und Leichter und war der reichste in Neu-England. Das neue Zollhaus in der Wall Street war das stolze Wahrzeichen der jungen amerikanischen Wirtschaftsmacht und erstreckte sich über eine Länge von 46 Meter. 12.000 Schiffe legten pro Jahr an den New Yorker Piers an, die wie die Zähne eines Kamms die Halbinsel Manhattan umgaben.
Den Hut tief in die Stirn gezogen, kontrollierte Mr. Melville die Frachtlisten, warf einen Blick in die Laderäume. Während die gewaltigen Überseefrachter an der südlichen Battery anlegten und abgefertigt wurden, waren die alten Hafenanlagen etwa in Höhe des Madison Square, wo Getreide und Fleisch aus dem Inneren des Landes verschifft wurden, der Bauch von New York, Sammelplatz des internationalen Proletariats. Melvilles Arbeitsplatz, das alte Zollhaus in der West Street, am Rand des Fabrikviertels, war ein schlichter Backsteinbau, umgeben von hölzernen Speichern und verfallenden Schuppen.
19 Jahre lang, von 1866 bis 1885, blieb Herman Melville Zollinspektor. Der prächtige Vollbart verdeckte ein fein gezeichnetes Gesicht mit schmalen Augen. Er kannte das Schiffsvolk, das nachts in den Hurenhäusern und Kneipen von SoHo und Chinatown verschwand. Es waren Männer aus allen Ecken der Welt, die sich für wenige Cents am Tag mit Leib und Seele an die Reeder verkauften. Zu ihnen hatte er vier Jahre gehört, mit ihnen gelebt, ihre Sprache studiert, ihre Einsamkeit, ihre Grobheiten. Seine „gnadenlos demokratische Gesinnung“ erlaubte ihm nicht, zwischen sich und ihnen einen Unterschied zu machen. Christliche Nächstenliebe war die Grundbedingung: ein Mensch zu sein. Und so erfuhren jene Männer, mit denen er täglich mehr Zeit verbrachte als mit seiner Familie, auch nicht, dass der schweigsame Mann so um die Fünfzig, der so geschickt zwischen Tauen und Fallreeps umhersprang, einmal ein berühmter Schriftsteller gewesen war.
Jetzt war er vergessen. Trotzdem schrieb er, wenn er spät in der Nacht an seinen Schreibtisch in der East 26th Street zurückkehrte, an einem tausendstrophigen Vers-Epos über das heilige Jerusalem, auf der Suche nach dem „echten Jona-Gefühl“ im Bauch eines Wals.
Auf die Welt kam Herman Melville am 1. August 1819 in New York City als das dritte von acht Kindern des von schottischen Einwanderern abstammenden Importkaufmanns Allan Melvill und der aus einer ursprünglich niederländischen Patrizierfamilie stammenden Maria Gansevoort Melvill. Auch Allan Melvill kam aus einer durchaus angesehenen Familie, doch zeigte er als Geschäftsmann keine besondere Begabung. Um einen großbürgerlichen Lebensstil finanzieren zu können, verschuldete er sich sehr und sein Unternehmen in New York City ging 1830 in Konkurs, woraufhin er die mittlerweile recht große Familie als Verkäufer in einem Pelzgeschäft in Albany finanziell über Wasser zu halten versuchte. Bereits mit zwölf Jahren musste also Herman 1831 die Schule verlassen. Ein Jahr später starb der Vater, seelisch und körperlich erschöpft und die Mutter änderte nach seinem Tode den Familiennamen in Melville. Herman arbeitete, um die Familie zu unterstützen, als kaufmännische Hilfskraft in einer Bank, als Gehilfe auf der Farm seines Onkels und half im Pelzgeschäft seines Bruders aus.
1839 (er war 20 Jahre alt) heuerte er als Matrose auf einem Postschiff auf der Route von New York nach Liverpool an. Danach versuchte er sich als Lehrer in einer Grundschule in New York City, gab diese Stelle jedoch ein Jahr später wieder auf, um Anfang Januar 1841 in Nantucket an Bord des Walfängers „Acushnet“ in See zu stechen. Die Bedingungen auf der Fangfahrt in den Pazifik waren aber so unzumutbar, dass er 1842 bereits beim ersten Zwischenhalt auf der Insel Nuku Hiva (Marquesas) „desertierte“. Er entfloh gemeinsam mit dem Matrosen Richard Tobbias Greene durch die Berge, um das Tal von Taipivai zu erreichen, wo sie von den Typees, einem Insulaner-Stamm, gefangen genommen wurden. Nach einigen Tagen gelang Greene die Flucht aus der Gefangenschaft, während der am Bein verletzte Melville vier Wochen lang das Leben des Stammes beobachten konnte. Seine Erlebnisse ließ er schließlich in „Typee“ (1848) einfließen.
Auf dem australischen Walfänger „Lucy Ann“ entkam er dann endlich und gelangte nach Tahiti, wo er wegen Teilnahme an einer Rebellion auf der „Lucy Ann“ verhaftet wurde, konnte aber aus dem Gefängnis nach Moorea fliehen. Er heuerte als Bootssteuerer auf dem Walfänger „Charles and Henry“ aus Nantucket an und ließ sich im April 1843 auf Hawaii wieder abmustern. Im August desselben Jahres heuerte er dann in Honolulu als einfacher Matrose auf der nordamerikanischen Fregatte „United States“ an und kehrte, mit Zwischenaufenthalt in Peru, im Oktober 1844 nach Boston zurück.
In Boston schrieb er seinen ersten Roman „Typee“, der die Reise zweier Deserteure durch die Südsee beschreibt. Nach monatelanger Seefahrt flieht Tom, ein junger Matrose, gemeinsam mit seinem Kameraden Toby von einem Walfangschiff auf die Südseeinsel Nuku Hiva. Dort geraten die beiden in die Hände der berühmt-berüchtigten Typee, die sie zwar wie Gäste behandeln, aber in Wirklichkeit gefangen halten. Die Männer verbringen einige Wochen bei den Eingeborenen, lernen deren wunderliche Sitten kennen und kommen in den Genuss eines Lebens fernab von jeglicher Zivilisation. Bis Tom sich nach Tobys Verschwinden zunächst um das Leben seines Freundes, dann um sein eigenes sorgen muss und schließlich eine abenteuerliche Flucht wagt.
Das Buch trug keine gängige Gattungsbezeichnung, und genau diese Uneindeutigkeit machte 1846 wohl seinen Erfolg aus. Es war ein Bericht, ganz nahe an Melvilles eigenen Erlebnissen. Ob es aber sexuell tatsächlich so freizügig bei den Typee zugegangen ist, wie im Buch vom Ich-Erzähler Tom berichtet, kann mangels anderer Berichte nicht mehr rekonstruiert werden. Seine Erzählung traf jedenfalls genau den Nerv im prüden England und dem noch prüderen Amerika, trotz seiner Kritik am Kolonialismus und der vorbehaltlosen Darstellung der Indigenen. Der Untertitel tat das Seine dazu: „A Peep at Polynesian Life“. Und es wurde Melvilles größter kommerzieller Erfolg.
Auch „Omoo“ (1847), sein zweiter Roman, kam sehr gut bei ihren Lesern an. Es schloss unmittelbar an „Typee“ an. „Omoo“, entnommen dem auf den Marquesas gesprochenen Dialekt, hat dabei die Bedeutung von Herumtreiber oder Inselwanderer. Nach seiner Flucht aus dem Typee-Tal hat es den Icherzähler nach Tahiti verschlagen. Tahiti war allerdings kein unberührtes Naturparadies mehr, sondern war mehr und mehr unter den Einfluss der Kolonialmächte geraten. In einer Abfolge locker miteinander verbundener Episoden schildert Melville seine Erlebnisse mit dem seltsam-bizarren Völkergemisch, ehe er letztlich auf einem Walfänger nach Nantucket zurückkehrte.
Die Tantiemen für „Omoo“ ermöglichten ihm schließlich die Heirat mit Elizabeth Shaw im August 1847 in Boston. Sie bekamen zwei Töchter und zwei Söhne, von denen der ältere sich mit 18 Jahren das Leben nahm und der jüngere, Stanwix, mit 35 Jahren an Tuberkulose starb.
MARDI
In seinem dritten Roman „Mardi und eine Reise dorthin“ (1847) sah Melville eine Wende in seinem Schaffen. Das Südseeabenteuer entwickelt sich nach der Flucht zweier Seefahrer weiter zur Seelenreise und Kosmogonie und endet in einer allegorischen Satire, in der er die Vergeblichkeit nationalstaatlichen Machtstrebens karikiert. Die zahlreichen Diskurse, das Anhäufen von Beschreibungen, die reiche sprachliche und stilistische Variation und Schilderung seelisch-leiblicher Vorgänge, die die Ausweglosigkeit und Absurdität und auch Tragik des Handelnden zeigen, kann man mit der Totalität des Epos im modernen Roman vergleichen.
„Mardi“, sein erster wirklicher Roman, sein erstes die Seiten (mehr als tausend) und die Zeiten sprengendes Werk, das die Kritiker und die Leser enttäuschte und überforderte. „Ein solches Buch hat man noch nicht gesehen“, so Ulrich Greiner, „ein Zauberkunststück, ein irrer und wirrer Faselteppich; Räuberpistole und Südseeromanze, philosophisch-theologischer Traktat und haltlose Humoreske. Die Lektüre gleicht einer Expedition in die Wildnis, wo Paradiese locken und Wüsteneien lauern, und die Reise dorthin erfordert. um es gleich zu sagen, Ausdauer und Langmut.“
Melville hat es gewusst. Nach mehr als 800 Seiten gesteht er: „Ich wurde von einem unwiderstehlichen Windstoß von meinem Kurs abgebracht. Dieser Anprall, dem ich mich beuge, trifft mich in allzu jungen Jahren, wo ich noch unerfahren und schlecht ausgerüstet bin; und dennoch fliege ich vor dem Sturm.“ Aber weit davon entfernt, zerknirscht zu sein, ruft er begeistert: „Hört, o Leser! Ich bin ohne Karte gereist. Mit Kompass und Blei hätten wir diese Inseln von Mardi nicht gefunden. Wer kühn in See sticht, kappt alle Taue und wendet sich von der gewöhnlichen Brise ab, die jedermann gewogen ist; und füllt die Segel mit seinem eigenen Atem. Klebt man an der Küste, sieht man nichts Neues.“
In den zwei darauffolgenden Werken „Redburn“ (1849) und „White-Jacket“ (1849, „Weißjacke“) wählte Melville das Schiff als Mikrokosmos. Obwohl er beide Werke wegen ihrer vermeintlich mangelnden sprachlichen Kraft später abwertete, nicht zuletzt aufgrund ihrer zum Vorgängerroman geringeren Innovationsdichte, können sie als Intensivierung wie Straffung seines Vorgängers gelesen werden. Im Gegensatz zu „Mardi“ sind die Hauptfiguren nicht nur als Allegorien oder Stellvertreter von Ideen gezeichnet, sondern als Charaktere fassbar und in der weißen Jacke des namenlosen Matrosen fasst Melville erstmals das Symbol des Nichts wie später im Wal „Moby Dick“. Als maritime Romane gehören sie wegen ihres Realismus zu Melvilles zugänglichen Werken.
1849 reiste er nach England, um seinem Verleger die Manuskripte von „White-Jacket“ zu überbringen und besuchte auch Paris und das Rheinland. Im Februar 1850 kehrte er nach New York City zurück und erwarb mit dem Geld des Schwiegervaters Shaw einen kleinen Bauernhof namens Arrowhead bei Pittsfield, Massachusetts, auf dem sie bis 1863 lebten. Melville bestellte den Hof, schrieb seine Bücher und hielt gelegentlich Vorträge über seine Erlebnisse im Pazifik.
MOBY DICK
Den Misserfolgen schickte Melville gleich einen weiteren, noch größeren, hinterher: „Moby-Dick; or, The Whale“ (1851). Da war er gerade mal Anfang Dreißig. Da hatte er in fünf Jahren sechs dicke Bücher veröffentlicht. Gleich nach dem Erwerb des Bauernhofes verarbeitete er die Erlebnisse auf der „Acushnet“ und der „Charles and Henry“ zu einem zunächst in England in drei Bänden unter dem Titel „The Whale“ erschienenen Roman.
Der Nathaniel Hawthorne gewidmete Roman erzählt aus der Perspektive des Ich-Erzählers Ismael die Fangreise und Geschichte des Walfangschiffes „Pequod“ und seines Kapitäns Ahab, der von der Jagd nach dem legendären weißen Pottwal besessen war. Er jagte den Wal mit einer Verbissenheit, die zur Zerstörung des Schiffs und seinem eigenen Tod führte. Neben diesem zentralen Handlungsfaden sind weitschweifige überwiegend philosophische, halbwissenschaftliche, geschichtliche und mythologische Betrachtungen des Autors eingeflochten.
Bereits auf seiner Südsee-Reise 1841 war er dem Kapitän Owen Chase (den Melville Chace nannte) und davor wiederum dessen Sohn begegnet. Der Sohn zeigte ihm das von seinem Vater seinerzeit als Erster Steuermann verfasste Buch über den Untergang des Walfängers „Essex“ nach einem Pottwal-Angriff, von dem nur wenige Exemplare existierten. Erst 1850 bekam Melville ein Exemplar des Buches. Der Beginn der darin beschriebenen Tragödie (der Pottwalangriff) beeindruckte ihn so sehr, dass er ihn dann zum grandiosen Ende des Romans machte.
Im August 1850 hatte er Roman weitgehend beendet und schrieb an seinen britischen Verleger Richard Bentley: „Im kommenden Spätherbst sollte ich mit einem neuen Werk fertig sein […] ein Abenteuerroman, der auf gewissen wilden Legenden aus den Pottwalfanggebieten im Süden gründet, ausgeschmückt mit den eigenen persönlichen Erfahrungen des Autors aus seiner mehr als zweijährigen Zeit als Harpunier. […] Ich wüsste nicht, dass das behandelte Thema jemals von einem Romancier, ja überhaupt von irgendeinem Schriftsteller in angemessener Weise bearbeitet worden wäre.“
Die Jagd auf den weißen Wal. Der Kampf eines Mannes gegen die Bestie, gegen das Böse und gegen das Schicksal, nichts Geringeres treibt Kapitän Ahab an bei seiner Jagd auf Moby Dick, den weißen Wal, der ihm einst wohl nicht nur sein linkes Bein, sondern auch seine Seele geraubt zu haben scheint. Viele, die den Roman zu kennen glauben, kennen wohl nur die halbe Geschichte. Neben dem allseits bekannten Abenteuer besteht der Roman auch aus ausufernden naturwissenschaftlichen Abhandlungen über den Walfang und philosophischen Betrachtungen über die Natur und ihre Zerstörungskraft. Zu viel Gedankenballast für manche Leser – so sind vor allem die bereinigten und gekürzten Adaptionen für Kinder und Jugendliche sowie die Verfilmungen bekannt geworden. Der Mehrdeutigkeit der geschilderten Ereignisse, dem ungewöhnlichen Aufbau und den wechselnden Erzählperspektiven verdankt der Roman jedoch seine Modernität. Die gleichen Gründe führten eben auch zu seiner Ablehnung und vernichtenden Kritik durch die Zeitgenossen.
Die Geschichte von Moby Dick, der Kampf eines einzigen Mannes gegen eine Bestie, das Böse und (s)ein Schicksal hat sich zu einem wahren Mythos amerikanischer Literatur entwickelt. Der epische Konflikt zwischen dem Wal und Kapitän Ahab auf seiner Jagd ist keine leichte Lektüre, jedoch zweifellos ein besonders vielschichtiges Beispiel für den symbolischen Realismus und ein überaus spannender Abenteuerroman. Der ungewöhnliche Aufbau, die geschilderte Mehrdeutigkeit sowie die wechselnden Erzählperspektiven tragen zur zeitlosen Modernität dieses Klassikers bei. Er ist einer der größten Romane der Weltliteratur. Zu seinen Lebzeiten (also innerhalb von 40 Jahren bis Melvilles Tod) wurden tatsächlich nur etwa 3000 Exemplare von „Moby Dick“ verkauft.
PIERRE
Nach den Misserfolgen seiner letzten Romane als Reaktion auf seine erzählerische Eigentümlichkeit wie verwegene Themenwahl behandelt er mit dem darauffolgenden Eheroman „Pierre“ (1852) einen geschwisterlichen Inzest. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der alles aufs Spiel setzt, als er mit seiner Geliebten, einer bedrohlichen Schönheit, nach New York flieht und nicht nur seine Verlobte, sondern sein ganzes bisheriges Leben hinter sich lässt. Ein Roman voller Tragik und Leidenschaft.
„Pierre“ sei „das Zentrum von Melville“, hat der britische Schriftsteller Grant Watson geschrieben und (vielleicht als Psychotherapeut, der er auch war) hinzugefügt: „Wenn man ihn verstehen will, muss man dieses Buch vor allen anderen verstehen.“ Melville selbst gibt nur einen dezenten Hinweis: „Auf diesem Blatte scheint er unmittelbar seine Erfahrungen plagiiert zu haben“, heißt es einmal in „Pierre“. Ein autobiografischer Roman?
Das Buch vom Wahn ist ein Buch zum Verrücktwerden. Der Roman wird wohl für alle Ewigkeit Melvilles umstrittenstes Werk bleiben. „Wer sich auf die verborgene Symbolik einlässt, wird herausfinden, dass es sein größtes Buch ist“, befand Grant Watson, „der Phantasiereichtum steht den besten Teilen von ‚Moby Dick‘ in nichts nach, und der Stil ist weniger überfrachtet.“ Dagegen steht John Updikes Urteil: „Es darf bezweifelt werden, ob je sonst in der Literaturgeschichte ein so gutes und ein so schlechtes Buch wie ‚Moby-Dick‘ und ‚Pierre‘ nacheinander geschrieben wurden. Die Handlung ist hysterisch, der Stil tobt und ist unbeständig, die Figuren werden von einer unerklärten Raserei des Autors hin und her gezerrt.“
VON BARTLEBY BIS BILLY BUDD
„Ich möchte lieber nicht ...“, Herman Melvilles Erzählung „Bartleby, the Scrivener“ (1853, „Bartleby, der Schreiber“) über Sinnlosigkeit und Verzweiflung, über Verstummen und Verweigerung ist heute so modern wie bei ihrem Erscheinen vor über 150 Jahren. Darin erzählt ein namenloser Anwalt die Geschichte seines lichtlosen Büros in der Wall Street. Zu seinen bereits relativ verschrobenen Angestellten kommt ein neuer, junger Schreiber, Bartleby. Pflichtbewusst und schweigsam kopiert er Verträge, weigert sich jedoch standfest, irgendeine andere Aufgabe zu übernehmen, denn er ist ja als Schreiber angestellt. „Ich möchte lieber nicht!“, ist alles, was er sagt. Die Kult-Erzählung gilt als eines der wichtigsten Werke von Melville und als Vorläufer existenzialistischer und absurder Literatur.
In der großartigen Novelle „Benito Cereno“ (1855) nimmt Kapitän Amaso Delano im Morgengrauen ein fremdes Schiff wahr, unkontrolliert und ohne Flagge treibt es auf den Hafen zu, in dem er vor Anker liegt. Delano vermutet, dass das Schiff in Seenot geraten ist, und möchte helfen. Doch damit bringt er sich in große Schwierigkeiten, denn auf dem Schiff haben aufständische schwarze Sklaven das Kommando übernommen und der einstige Kapitän Benito Cereno muss um sein Leben fürchten. „Benito Cereno“ lässt sich auch leicht etwa auf heutige Geiselnahmen oder Entführungen übertragen. Mit Recht hat Melvilles Biograph Andrew Delbanco die Novelle deshalb als aktuellstes seiner Werke bezeichnet: „Verzweifelte Menschen im Griff einer rachsüchtigen Wut, die von denen, gegen die sie sich richtet, nicht einmal ansatzweise verstanden wird“. Es ist eine vielschichtig erzählte Novelle über die Konsequenzen von Rassismus und das Ausmaß menschlicher Grausamkeit, die mit ihrer indirekten Erzählweise und der ironisch unterlegten perspektivischen Erzähltechnik eine Form prägte, die später von Henry James weiterentwickelt und perfektioniert wurde.
Im Roman „Israel Potter“ (1855) schildert er sodann die Odyssee des Bauernsohnes Israel aus Neuengland, der aus Liebeskummer in die Revolutionsarmee eintritt und während der amerikanischen Unabhängigkeitskriege in englische Gefangenschaft gerät. In England gelingt ihm die Flucht, er macht in Paris die Bekanntschaft von Benjamin Franklin und kämpft zusammen mit dem Piraten Paul Jones zur See gegen die Briten. Nach Kriegsende muss er, von seinem Vaterland inzwischen vergessen, im englischen Exil weiter als Flüchtling leben. Erst als alter Mann kehrt er in seine Heimat zurück, die ihm längst fremd geworden ist.
1857 erschien mit „The Confidence-Man“ („Maskeraden oder Vertrauen gegen Vertrauen“) Melvilles letzter Roman. Am sogenannten Fools‘ Day (einem 1. April) läuft in St. Louis bei Sonnenaufgang der Mississippi-Dampfer „Fidele“ Richtung New Orleans aus mit buntgemischten Passagieren: Aktienagenten, Wundermittelverkäufer, Geschäftsmänner, Bettler, Barbiere, Studenten – und einem höchst seltsamen Passagier, der ständig seine Verkleidungen und Maskeraden verändert. Mal tritt der rätselhafte Fremde als sanfter, taubstummer Mann an Bord auf und hält eine Tafel mit der Aufschrift „Christliche Nächstenliebe und Barmherzigkeit“ in der Hand, mal wirft er sich einen grauen Mantel über und wirbt für ein indianisches Witwen- und Waisenhaus, dann wieder gibt er sich als Vermittler von Arbeitskräften aus.
Doch alle diese Maskeraden dienen nur einem Zweck, nämlich die Menschen zu verspotten und ihre Moral als Eitelkeit und Heuchelei zu entlarven. Bei jeder Begegnung stellt der Fremde die christlichen Werte seiner Zeitgenossen auf den Prüfstand und legt die Schwächen der amerikanischen Gesellschaft bloß, die sich etwa in der grausamen Behandlung eines verkrüppelten schwarzen Bettlers an Bord drastisch zeigen. Niemand kennt den Namen oder die Herkunft des Mannes, niemand hat eine Ahnung, wer er ist und was er bezweckt. Ist er ein unverbesserlicher Menschenfreund, der an das Gute im Menschen glaubt oder ein Teufel, ein spöttischer Zyniker, ein Betrüger? Während das Narrenschiff auf dem Strom dahingleitet, entlarvt der Erzähler Melville mit dem schonungslosen Blick eines Satirikers eine Welt voll von Täuschungen und Maskeraden, eine Gesellschaft voller Argwohn und Schurkerei.
Ab 1856 wurde Melville von schwerem Rheuma geplagt und von seiner Familie und dem Schwiegervater zu einer Erholungsreise gedrängt, die ihn nach England, wo er den Schriftsteller Nathaniel Hawthorne traf, ans Mittelmeer und ins Heilige Land führte. Im Mai 1857 kehrte er zurück.
Im Jahr 1860 segelte er auf dem Klipper „Meteor“ unter dem Kommando seines jüngeren Bruders Tom nach San Francisco, Kalifornien. Obwohl er ursprünglich eine Weltreise geplant hatte, eilte er von dort mit einem Dampfer bald wieder zurück. Drei Jahre später verkaufte er den Hof in Pittsfield und siedelte nach New York über. Obwohl bis zuletzt weiter schreibend, konnte er ab den 1860er-Jahren nicht mehr von der Schriftstellerei leben. Deshalb musste der ehemalige Seefahrer und berühmte Schriftsteller bis zu seinem Renteneintritt im Dezember 1885 als Zöllner im New Yorker Hafen arbeiten.
Im späten Alter verfasste er seinen ersten Gedichtband, das Versepos „Clarel“ und den Gedichtband „John Marr and Other Sailors“. Hundert Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung in einer Auflage von 330 Exemplaren auf Kosten des Autors erschienen, erwies es sich nach kurzem als ein weiterer Fehlschlag in seiner literarischen Karriere. Clarel, ein junger amerikanischer Student, unternimmt darin eine Reise nach Jerusalem. Dort verweben sich biblische Vorzeit und Jetztzeit, verknüpfen sich all die gesehenen und imaginierten Landschaften und alle Seelenbestrebungen zu einem großartigen Teppich von melancholischer Wortpracht. Grandiose Wüstenszenerien und Südseereminiszenzen vermischen sich mit Fantasien von antiker Freizügigkeit und asketischen Modellen von Christentum und Islam. „Clarel“ mit seinen 18.000 Versen ist ein Traumspiel, worin Zeiten, Mythen und Stoffe zu einer schillernden poetischen Präsenz gebündelt wurden.
An Überarbeitungen der rätselhaften, mythischen Geschichte von Schuld und Tod „Billy Budd“ hat Melville schließlich bis zu seinem Tod gearbeitet. Postum herausgegeben, erlangte sie, obwohl nicht ganz abgeschlossen, Weltruhm. Ein Unschuldiger wird der Disziplin geopfert. „Billy Budd“ ist mehr als nur eine spannende Seemannsgeschichte: Ein junger und schöner Matrose, allseits beliebt, wird erstmals mit boshaftem Verhalten konfrontiert, als er grundlos der Meuterei bezichtigt wird, sich mit Worten nicht wehren kann und seinen Widersacher unbeabsichtigt erschlägt. Seemännischen Prinzipien zuliebe lässt ihn sein geliebter Kapitän hinrichten. Melvilles vielschichtige Novelle überrascht mit einer Fülle von ästhetischen, moralischen und historischen Motiven. Weil der Erzähler von seinen Figuren nicht mehr zu wissen scheint als der Leser, weil er vieles nur andeutet und sich jeder umfassenden Erklärung verweigert, lässt er Platz für mannigfache Interpretationen. Was geht in Billy kurz vor seinem Tod vor? Ist Kapitän Vere gut oder böse? Der unterschwellige Pessimismus und die wankenden Gewissheiten machen Melvilles letztes Buch zu einem gleichsam modernen Werk.
Herman Melville starb am 28. September 1891 im Alter von 72 Jahren; sein Grab befindet sich auf dem Woodlawn Cemetery im New Yorker Bezirk Bronx.
Als er starb, war er in der literarischen Welt längst vergessen, verschluckt von den bis heute rätselhaften Abgründen seiner eigenen Schöpfungen. In Meyers deutschem Universallexikon war er bereits 1871 für tot erklärt worden. Mit der europäischen Wiederentdeckung zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zwar seine metaphysischen Obsessionen, sein zweifelhafter Ruf als neoromantischer Mystiker einer genaueren Prüfung unterzogen.
Aber dem Rätsel Herman Melville kamen bis heute weder seine Bewunderer noch seine Kritiker auf die Spur. Die Welt erinnerte sich, wenn überhaupt, an einen „schlechten“ Schriftsteller.