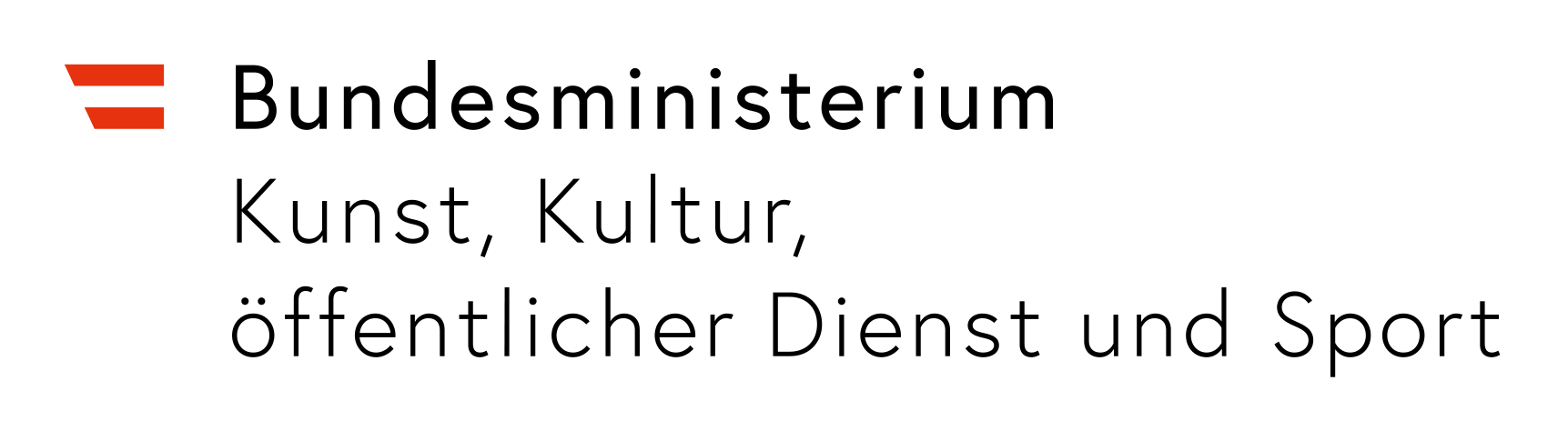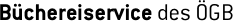Herta Müller - Eine dunkle Wortzauberei, die die Realität genau ins Auge fasst

Veröffentlicht am 16.04.2023
Die Nobelpreisträgerin wird 70 Jahre alt. Ein Porträt von Brigitte Winter.
Vor 40 Jahren hat die im rumänischen Nitzkydorf geborene Herta Müller ihr erstes Buch veröffentlicht. Schon die ersten Erzählungen trafen im Westen einen Nerv. Herta Müller wurde zu Lesungen und zur Frankfurter Buchmesse eingeladen. Nachdem sie Rumänien 1987 verlassen hatte, begann ihre Karriere erst richtig und wurde 2009 mit dem Nobelpreis für Literatur gekrönt. Seitens des rumänischen Geheimdienstes und seiner Handlanger wurde hingegen schon früh eine Rufmordkampagne inszeniert. Nur weil sie Dinge beschrieb, über die sonst niemand sprach.
„1953 bin ich in Nitzkydorf geboren, das Jahr, in dem Stalin körperlich starb – geistig lebte er noch viele Jahre. Das Dorf liegt im rumänischen Banat, zwei Autostunden zu Belgrad oder Budapest. Eine Bauernbevölkerung, weiße, rosa, hellblaue Giebel – oder Triangelhäuser in symmetrisch laufenden Straßen. Mein Vater hasste Feldarbeit und wurde, als er 1945 aus der SS nach Hause kam, LKW-Fahrer und Alkoholiker. Auf Feldwegen geht das zusammen. Meine Mutter war und blieb Bäuerin auf den Mais- und Sonnenblumenfeldern. Mais ist für mich die sozialistische Pflanze schlechthin: er hat Fahnen, wächst in Kolonnen, raubt den Blick, und seine Blätter schneiden bei der Arbeit in die Hände. Im Maisfeld wird man an einem einzigen Tag vom Kind zum Greis. So erkläre ich mir, daß meine Mutter schon mit Ende zwanzig für mich eine alte Frau war.
Sturheit in der Schufterei, Ethnozentrismus und keinerlei Reue für die Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus – es sind die drei Grundeigenschaften dieser deutschen Minderheit, aus der ich komme. Ich wurde fürs Weiterführen dieses Lebensmusters erzogen: Waschen, Putzen, Kühemelken, Strümpfe stopfen. Nebenbei fiel der Satz: ‚Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, wäre hier Deutschland.‘ Aber um welchen Preis?“
Niemand könnte die Lebenswelt, in die Herta Müller als Tochter der Minderheit der Deutsch sprechenden Banater Schwaben in Rumänien hineingeboren ist, besser beschreiben als sie selber. Im kargen Bauernhaus ihrer Eltern gab es keine Bücher aus Gebetbücher und den Band „Die deutsche Lebensschule“ ihres im Krieg gefallenen Nazionkels. Von Frühjahr bis Spätherbst musste sie Kühe hüten. Und mit 15 konnte sie aufs Gymnasium nach Temeswar gehen – „und musste einsehen, dass diese deutsch-dörfliche Erziehung 30 km weiter, in der Stadt, nichts taugte. Dass ich dies Dorf nie mochte, wurde mir klar, dennoch hatte ich zwei Jahre großes Heimweh – das ist kein Widerspruch. Ich lernte schnell Rumänisch, wollte ein Stadtmensch sein. Ich begann Bücher zu lesen. Das wichtigste: Eugen Kogons ‚Der SS-Staat‘. Ich las das Buch mit Angst, dass der Name meines Vaters in der nächsten Zeile steht, weil er mir nichts vom Krieg erzählte, die Rumäniendeutschen aber als KZ-Wächter in dem Buch vorkamen. Durch das Buch begriff ich aber auch, dass ich jetzt so alt bin wie mein Vater als SS-Soldat und das Land um mich herum eine andere Art Diktatur ist.“
Nach dem Gymnasium studierte sie Germanistik und Rumänistik und stieß auf Gleichaltrige, die viel lasen und selber schrieben. Sie wurden ihre engsten Freunde und waren bereits in den Fängen des Geheimdienstes, denn sie hatten die „Aktionsgruppe Banat“ gegründet und ein Programm formuliert, das „die dienende Literatur jeder Couleur ablehnte: die Heimatliteratur, die Nazi- und Stalindienerei, den sozialistischen Realismus“. Stattdessen verlangten sie den kritischen Blick und individuelle, moralische Verantwortung als Voraussetzungen fürs Schreiben. Das war ein Affront gegen die meisten Schriftsteller im Land und naturgemäß gegen das Regime. Es folgten Verhöre, Haussuchungen, Exmatrikulation von der Uni und Verhaftungen. Die Gruppe wurde zerschlagen.
Doch ihr, die selber schrieb, tat man nichts. Nach dem Studium wurde sie Übersetzerin in einer Maschinenbaufabrik. Ihr Vater starb und ihre erste Ehe ging in Brüche: „Ich begann, um zu begreifen, wer ich bin, die ‚Niederungen‘ zu schreiben.“ Und der Geheimdienst begann seine Besuche in der Fabrik, mit Drohungen, auch mit dem Tod. Nach einer Woche zeigte sich, man wollte sie weich machen, sie sollte eine IM-Erklärung schreiben, der Geheimdienstler diktierte. Doch sie weigerte sich und wurde entlassen. Ab diesem Tag hatte sie nur wenige Tage ohne Schikanen. Ohne Arbeit gehörte sie nun zu den „parasitären Elementen“ und dafür gab’s Zwangsarbeit oder Gefängnis. Man drohte mit beidem.
Vier Jahre lang lag ihr Manuskript „Niederungen“ bei einem Bukarester Verlag, ehe es 1982 Zensur verstümmelt erscheinen konnte. Zwei Jahre später erschien es im West-Berliner Rotbuch Verlag (es war ihr gelungen, das Manuskript in den Westen schmuggeln zu lassen). Sie bekam Literaturpreise in Deutschland und durfte vier Mal zu Preisverleihungen in den Westen: „Um nicht Aushängeschild zu sein, konnte ich die Reisen nur annehmen, wenn ich im Ausland sagte, was zu Hause passiert. Daran hielt ich mich. Ich kehrte vier Mal nach Rumänien zurück, für meine Freunde war das wichtig. Mein Wegbleiben hätte man gegen sie verwenden können.“
1985 war an ein Leben in Rumänien nicht mehr zu denken: „Das Regime schien ewig zu halten, ich aber war mit den Nerven am Ende. Ich verwechselte das Lachen mit dem Weinen, das Schweigen mit dem Reden. Ich schrie laut in den Straßen herum, galt als verrückt, war aber noch haarbreit normal. Ich beantragte die Ausreise, die man mir bei Verhören öfter angeboten hatte, um mich loszuwerden. Ich hatte jedesmal abgelehnt, meinend: ‚Es müsste nur Ceauçescu gehen, dann könnten alle anderen bleiben.‘ Jetzt wollte ich. Ich verweigerte die für Rumäniendeutsche übliche ‚Familienzusammenführung‘ und bestand auf der Ausreise aus politischen Gründen. Nach anderthalb Jahren ließ man mich gehen, meine Mutter wurde mitgepackt.“
1987 kam sie in Nürnberg an. Der rumänische Geheimdienst hatte in ihren Papieren den 29. Februar geschrieben, doch der Februar in jenem Jahr hatte nur 28 Tage. Die Deutschen machten ihr deswegen Schwierigkeiten, aber auch, weil sie auf politische Verfolgung bestand und keine Aussiedlerin sein wollte: „Mit dem Bundesnachrichtendienst musste ich drei Tage über mein Leben reden, meine Mutter und die anderen angekommenen ‚gewöhnlichen‘ Deutschen zwei Minuten. Ich sollte mich entscheiden, ob ich eine Deutsche bin oder politisch verfolgt. Nach dem Übergangsheim zog ich nach Berlin. Meine Mutter bekam den deutschen Pass nach drei Monaten, ich nach anderthalb Jahren, es seien ‚eindringliche Recherchen‘ nötig, sagte man mir.“
Auch in Deutschland kam Herta Müller von Rumänien nicht los. Die Diktatur diktierte die Wirklichkeit, sie retuschierte, grenzte aus und vernichtete, säte Misstrauen und Hass. Sie okkupierte Sprache und verhinderte Reflexion. Rumänien ist nicht nur ein geografischer Ort, den sie 1987 verlassen hat, sondern auch ein Zustand und ein Trauma, die über Grenzen hinweg weiterwirken. „In meiner Stirn sind die Beschädigungen einer Einheimischen und die Bedenken eines fremden Passagiers“, so schreibt sie in „Hunger und Seide“ (1995). Zu Hause ist sie in ihrer Sprache. Es ist eine raue, fast körperliche Sprache, die im Grunde zwei Wurzeln hat, denn das Banater Deutsch ihrer Heimat vermischt sich mit der rumänischen Sprachwelt, die sie erst mit fünfzehn Jahren kennengelernt hat. Diese Sprache ist voller eigentümlicher Bilder, wie man sie sonst nirgendwo findet. Herta Müller ist misstrauisch und hellhörig geworden, sie klopft Begriffe genau ab, erkennt falsche Zwischentöne, besteht auf Nachfragen und ist um Differenzierung bemüht.
Niederungen
In ihrem Prosadebüt „Niederungen“ (1982) beschreibt sie mit dem unerbittlichen Blick des Kindes den Geburtsort ihrer Wahrnehmung und Sprache, das abseits gelegene Dorf, alles nur in Augenhöhe, selbst die Sprache konnte nicht mitwachsen, eine „Kinderbettsprache“ („Herztier“, 1994) innerhalb einer sprachlosen Umgebung. Hier macht sie die Erfahrung, dass dieses kleine Dorf in seinen Strukturen für den Staat steht, archaisch, Menschen verachtend und brutal im Denken und Handeln: „Und wo man etwas berührt, wird man verwundet.“ Im Folgenden ist es die tägliche Nichtübereinstimmung mit dem totalitären System, der Schatten der Verfolgung legt sich auf die Dinge, die allgegenwärtige Bedrohung und die daraus entstehende Angst (Grundmotiv all ihrer Texte) beschädigt die Wahrnehmungsfähigkeit. Der Sturz des Regimes und der Tod des Diktators 1989 haben bei Herta Müller vieles freigesetzt. Verschwommene Bilder bekamen nun Konturen und Gefühle nahmen sprachliche Gestalt an.
Im Roman „Der Fuchs war damals schon der Jäger“ (1992) sind es das Gift des Verrats, die Nahtstelle zur Freundschaft und die Erpressung durch den Geheimdienst Securitate, die die Verfolgten zermürben und verletzen. Der Fuchs ist dabei nur das Symbol für die Allgegenwart der Verfolger, die anonyme Macht wird plötzlich sichtbar und verbreitet Angst, diese fast paradoxe Symbiose zwischen Staatsmacht und Oppositionellen treibt alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, an die Grenzen des Wahns.
In „Herztier“ (1994), einem zentralen Text in ihrem Werk, werden aus der Sicht einer Frau die Verstrickungen einer Gruppe von Freunden erzählt, die als Studenten in ihrem Aufbegehren gegen das System zusammenfinden und, vom politischen Gegner gezielt in alle Winde zerstreut, Kontakt zu halten suchen. An Lolas Schicksal hatte sich ihr Widerstand entzündet. Ihre Beziehung mit einem Parteifunktionär wurde angezeigt, kurz darauf war sie tot. Spuren werden verwischt, man statuiert ein Exempel, diffamiert die junge Frau und macht ein Opfer zum Täter. Alle, auch die Erzählerin, ducken sich, niemand erhebt die Stimme.
Aus Gesprächen mit den drei jungen Männern entsteht jedoch eine intensive Bindung, sie lesen Bücher, schreiben Gedichte und dokumentieren mit Fotos. Behördliche Schikanen wie Zensur, Hausdurchsuchung, Verhör und Denunziation führen in die soziale Isolation. Der äußere Druck, der auf ihnen lastet, findet kein Ventil; gegenseitige Verletzungen sind die Folge. Allmählich schwindet ihre Kraft. Mürbe geworden, entschließen sie sich (mit einer Ausnahme) zur Ausreise. In Deutschland angekommen, erfahren sie, dass zwei Mitglieder ihrer Gruppe unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. An Knotenpunkten des Geschehens, das nie vom gesellschaftlichen Bezugssystem abgelöst wird, schaltet die Erzählerin in die Kindheit zurück und Stationen einer Entwicklung werden sichtbar gemacht, die in Verrat, Terror und Tod münden.
SS-Väter, „Blutsäufer“ und andere dumpfe Gestalten prägen eine unheilvolle, verrohte Wirklichkeit, deren Deformationen für die politische Entwicklung mitverantwortlich gemacht werden. Ausgangspunkt bleibt jedoch stets die besondere Erfahrung. Die Observation zwingt die Opfer in eine überscharfe, nervöse Wahrnehmung.
Im Roman „Heute wär ich mir lieber nicht begegnet“ (1997) schildert Herta Müller sehr offen ihre Erfahrungen mit dem täglichen Terror der Staatsmacht und geht damit über „Herztier“ in manchen Passagen noch hinaus. Auf dem Weg zu einem Verhör, zu dem die Erzählerin bestellt ist und vor dem sie panische Angst hat, benützt sie die Straßenbahn. Unterbrochen durch das Zu- und Aussteigen der Passagiere an den zahlreichen Haltestellen entsteht gleichsam ein Stationendrama.
Der jeweilige Halt gibt der Erzählerin Gelegenheit, die Beobachtung der Vorgänge in der Tramway zu unterbrechen und in Erinnerungen abzuschweifen. Wie auf dem Weg zum Schafott drängen sich Schlüsselerlebnisse schlaglichtartig in ihr Bewusstsein: Die erste Ehe mit dem Sohn eines „Parfümkommunisten“, der die Deportation ihrer Großeltern zu verantworten hat; die Arbeit in einer Textilfabrik, in der sie, die Zettel mit Heiratsangeboten ins Ausland schmuggelt, bespitzelt und denunziert wird; die Liebe zu Paul, der auch bald schikaniert und bei einem absichtlich herbeigeführten Unfall gefährdet wird; die inzestuösen Gelüste ihrer Kindheit; ihre schrille Freundin Lilli mit ihrem Hang zu alten Männern, der ihr bei einem Fluchtversuch an der ungarischen Grenze zum Verhängnis wurde; Erinnerungen an Familie, Freunde und Kollegen, an ein Land, das dem ständigen Druck durch eine überbordende Sexualität, durch Brutalität und exzessiven Alkoholgenuss zu entkommen sucht.
Diese permanente Hochspannung, in der Nerven wie „Glitzerdraht“ bloßliegen und die Totenlieder zum Galgenhumor zwingen, zeigt sich in jenen Traumata, die das Leben der Erzählerin prägen, seitdem sie „bestellt“ ist. Auf dem Weg zu ihrem sadistischen Peiniger, dem Major Albu, verpasst die Erzählerin die richtige Haltestelle und kann beobachten, wie Paul mit einem verdächtigen Mann vertraulichen Umgang pflegt. Sie wird einzig deshalb zum Opfer der Strategien des totalen Staates, weil sie ihr privates Glücksverlangen zu realisieren versucht. Sie ist keine Oppositionelle, sie weiß nicht, was der Major von ihr will. Umso schutzloser ist sie den Mechanismen der Geheimpolizei preisgegeben, und um so schwärzer wird der Albtraum, in den sie stürzt. Am Ende bedarf es nicht einmal mehr des Verhörs, um sie zu zerbrechen. Wieder steht die traumatische Erfahrung der Unterhöhlung selbst der persönlichsten zwischenmenschlichen Beziehungen und der Zerstörung aller Vertrauensverhältnisse durch den totalen Überwachungsstaat im Zentrum.
Doch während die Protagonisten der vorangegangenen Bücher Intellektuelle waren, die die Mechanismen des Staates zu durchschauen in der Lage waren (eine Lehrerin, eine Übersetzerin mit ihren Freunden), wird in diesem Roman eine Fabriksangestellte im Mittelpunkt. Es ist ein Roman vom verkehrten Glück in einer verkehrten Welt geschrieben. Er schließt sich mit seinen beiden Vorgängern „Der Fuchs war damals schon der Jäger“ (1992) und „Herztier“ (1994) zu einer Trilogie vom Leben in der Diktatur zusammen.
Atemschaukel
Im Jahre 2009 erhielt Herta Müller den Nobelpreis, kurz nachdem sie den Roman „Atemschaukel“ herausgebracht hatte, worin die Lagererfahrung aus der Perspektive eines Heranwachsenden geschildert wird. Nicht die eigenen Erfahrungen, sondern die ihres Freundes Oskar Pastior waren es, die hier zu Literatur wurden. Und Herta Müller hat lange mit dem Stil gekämpft, der sowohl den Gesetzen historischer Wahrhaftigkeit als auch der Poesie gehorchen sollte -und beides ist auf beeindruckende Weise gelungen. Das Lager der „Atemschaukel“ ist kein deutsches, es ist ein russisches Lager. Alle Rumäniendeutschen zwischen 17 und 45 Jahren (Oskar Pastior selbst stammte von Siebenbürger Sachsen ab) mussten nach dem Zweiten Weltkrieg für die Verbrechen der Nationalsozialisten büßen und beim Wiederaufbau der Sowjetunion helfen. Unter ihnen waren natürlich auch viele tatsächlich überzeugte Nazis und Rassisten.
Das Lager, in dem Pastior schuftete, lag in der Ukraine, und dort liegt auch das Lager, in das der Romanheld Leo Auberg für fünf Jahre seines jungen Lebens verfrachtet wird. Abgeholt wird er im Januar 1945, Leo ist 17 Jahre alt, ein typischer Pubertierender, wohnhaft im rumänischen Hermannstadt als Deutscher, der zunächst sogar froh ist, rauszukommen aus der Familienenge, Die Deportation absurderweise als Aufbruch und Befreiung aus der Überwachung durch die Familie erfährt, denn der junge Mann hat gerade seine Homosexualität entdeckt. Doch die Realität im Lager holt ihn bald ein. Die Ansammlung von Lagerbaracken, nach Männern und Frauen getrennt, bleibt im Roman abstrakt.
Wie unter der Lupe werden die Szenen beim Friseur betrachtet, die Liebeständel, die Schikane bis hin zur Folter, die Dramen ums Brot. Niemals sucht Herta Müller nach Erklärungen für das, was geschieht. Es ist eher so, als suche sie in der Erniedrigung aller die Würde des Einzelnen. Auch ihre Mutter ist in einem russischen Lager gewesen, hat darüber aber wohl nur in vorwurfsvollen Andeutungen gesprochen. Die Wahrnehmung des Lageralltags in „Atemschaukel“ eine eines der sprachlichen Benennung fähigen Menschen, eines Schriftstellers, wenngleich Leo Auberg selbst kein Schriftsteller ist, aber Oskar Pastior, auf dessen Biografie der Roman zurückgreift. Im Lager erfährt Leo alias Pastior, mit dem Herta Müller unendlich viele Gespräche geführt hatte, so etwas wie die Auflösung seines Ich. Die Macht über das, was vom Lagersubjekt übrigbleibt, übernimmt nicht etwa der russische Lagerkommandant oder der Kapo, sondern ein Wort namens „Hungerengel“.
Den Hungerengel muss man sich wie einen Geist vorstellen, den der Hungernde sich schafft, um gegen ihn kämpfen zu können. Das gelingt dem jungen Romanhelden auch, immerhin überlebt er die „Hautundknochenzeit“ im Unterschied zu vielen anderen, aber der Hungerengel nimmt Besitz von ihm für immer. Als nach drei Jahren härtester Haft plötzlich etwas Geld gezahlt wird und er auf dem Basar Essen kaufen kann und sein Fleisch wieder üppiger wird, da hat der Hungerengel ihn immer noch im Würgegriff. Das Lager hat seine Seele zugerichtet, auf Lebenszeit. Niemandem wird Leo jemals wieder sein Herz schenken können. „Atemschaukel“ führt in 64 kurzen Kapiteln an den Ort, der zur Chiffre des 20. Jahrhunderts schlechthin wurde: ins Lager. Verblüffend vor allem ist die Präzision, mit der sich Oskar Pastior erinnerte: welche Schaufel beim Kohleabladen ihm die liebste war, wie sich der Hungertod ankündigt, wie man Schlackoblocksteine trägt.
Gemeinsam waren Herta Müller und Pastior 2004 in die heutige Ukraine gereist, um sich das Lager anzusehen, in dem er als Gefangener unsäglich litt, Kohle schippen musste und fast verhungert wäre. Oskar Pastior starb 2006, während der Vorbereitungsarbeiten zu „Atemschaukel“, wenige Wochen, ehe ihm der Büchner-Preis verliehen wurde, und vier Jahre vor seiner Enttarnung als Securitate-Spitzel. Erpressbar durch seine Homosexualität und seine Lyrik, die als antisowjetisch interpretiert wurde, hatte er sich als IM „Otto Stein“ zur Mitarbeit verpflichtet und in zehn Jahren sieben Berichte abgeliefert. Seine Spitzeltätigkeit (kein großer Fall, eher banaler Alltag in der rumänischen Diktatur) wurde in den Medien aufgebauscht. Im Abstand einiger Jahre nach der Enttarnung Pastiors schrieb Herta Müller: „Pastior wurde nicht nur als Person dämonisiert, er wurde auch als Autor demontiert. … Und die selbst ernannte Literaturpolizei ermittelte noch weiter und entdeckte in den Texten das Fehlen jeder ethischen Dimension und das Fehlen jeden Inhalts und jeder Beziehung zur Existenz. Aber es ist doch genau umgekehrt. In meiner Zeit in Rumänien habe ich in Pastiors Texten eine dunkle Wortzauberei entdeckt, die die Realität genau ins Auge fasst.“ Genau dasselbe ist auch in ihren Texten zu entdecken.
Foto: (c) Chaperon