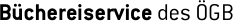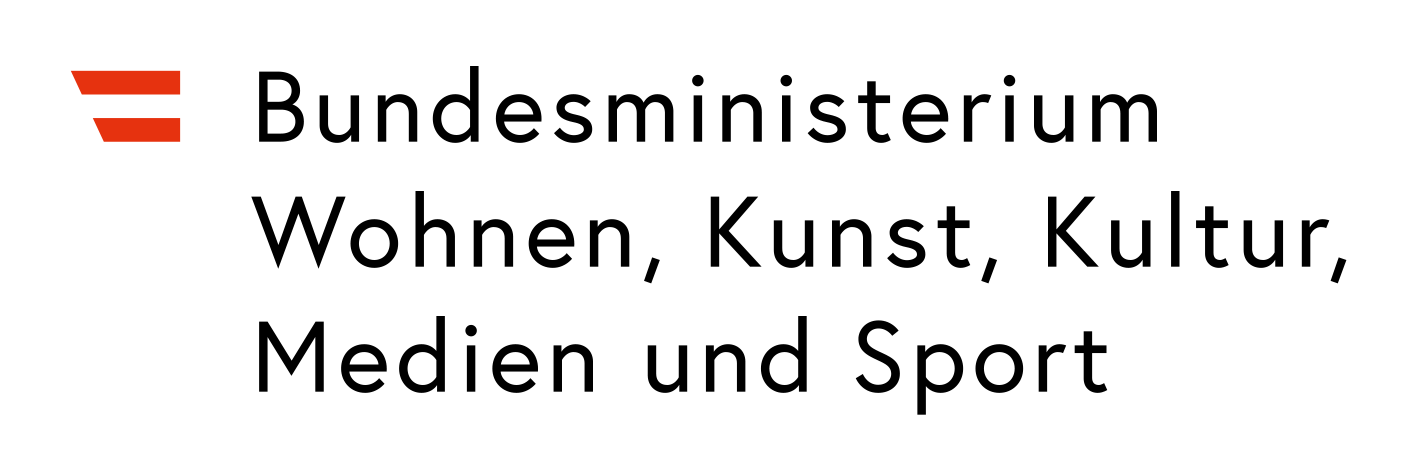László Krasznahorkai - Schönheit in der Sprache. Höllenspaß.

Dem ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai wurde der Literaturnobelpreis 2025 verliehen. Ein Porträt von Peter Klein.
Er war zwar seit Jahren im engeren Kreis der Favoriten, doch dass er nun tatsächlich den Literaturnobelpreis 2025 zugesprochen bekommen hat, überraschte dennoch. Die Schwedische Akademie würdigte László Krasznahorkai für das „fesselnde und visionäre Werk des 71-Jährigen, das inmitten apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt“. Bekannt ist Krasznahorkai für seine eher düsteren, dystopischen, melancholischen Romane, mit denen er zahlreiche Preise gewonnen hat, darunter den International Booker Prize 2015, den National Book Award 2019 für übersetzte Literatur und den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2021.
„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung mit dem Nobelpreis – vor allem, weil diese Auszeichnung beweist, dass Literatur jenseits verschiedener nicht-literarischer Erwartungen existiert und weiterhin gelesen wird“, reagierte Krasznahorkai selbst auf die Bekanntgabe der Verleihung des Literaturnobelpreises: „Und für diejenigen, die es lesen, bietet es eine gewisse Hoffnung, dass Schönheit, Adel und Erhabenheit um ihrer selbst willen noch existieren. Es kann sogar denen Hoffnung geben, in denen das Leben selbst nur noch schwach aufflackert.“ Seine Bücher werden oft als postmodern beschrieben und sind bekannt für ihre langen, verschlungenen Sätze (die 12 Kapitel von „Satanstango“ bestehen jeweils aus einem einzigen Absatz, sein bislang letzter übersetzter Roman „Herscht 07769“ aus einem einzigen, mehr als 400 Seiten langen Satz) und die Art von gleichsam unerbittlicher Intensität seines Schreibens hat Kritiker:innen dazu veranlasst, ihn mit Nikolaj Gogol, Herman Melville, Franz Kafka und Thomas Bernhard zu vergleichen.
„Krasznahorkai ist ein großer epischer Schriftsteller in der mitteleuropäischen Tradition, die von Kafka bis Thomas Bernhard reicht und sich durch Absurdität und groteske Exzesse auszeichnet“, so Anders Olsson, der Vorsitzende des Nobelkomitees, der Krasznahorkais Prosa auch als „eine Entwicklung hin zu einer fließenden Syntax mit langen, verschlungenen Sätzen ohne Punkte, die zu seinem Markenzeichen geworden ist“ beschrieb.
Susan Sontag bezeichnete ihn bewundernd als „den zeitgenössischen ungarischen Meister der Apokalypse“, während W.G. Sebald die Universalität seiner Vision lobte. Auf die Frage, wie er sein Werk beschreiben würde, antwortete Krasznahorkai 2015 in einem Interview mit dem The Guardian: „Briefe; dann aus Buchstaben Wörter; dann aus diesen Wörtern einige kurze Sätze; dann weitere längere Sätze, meist sehr lange Sätze, über einen Zeitraum von 35 Jahren. Schönheit in der Sprache. Höllenspaß.“ Zu Leser:innen, die sein Werk zum ersten Mal entdecken, fügte er hinzu: „Lesern, die meine Bücher noch nicht gelesen haben, kann ich keine Lektüre empfehlen. Stattdessen würde ich ihnen raten, rauszugehen, sich irgendwo hinzusetzen, vielleicht an einen Bach, nichts zu tun, nichts nachzudenken, einfach still zu verharren wie Steine. Irgendwann werden sie jemanden treffen, der meine Bücher bereits gelesen hat.“
Der Chronist des unaufhaltsamen Verfalls
Geboren wurde László Krasznahorkai 1954 in Gyula, einer kleinen Stadt an der rumänischen Grenze, in eine ungarische jüdische Familie. In einem Interview mit dem englischen Schriftsteller Adam Thirlwell (Paris Review 225, Sommer 2018) erzählte er von seiner Familie: „Ich komme aus einer bürgerlichen Welt, in der die kommunistische Theorie nie eine Rolle spielte. Wir waren Sozialdemokraten, meine Familie. Mein Vater war Anwalt und half armen Menschen. So sah mein Leben aus: Zwei oder drei Abende pro Woche kamen arme Leute zu uns, und mein Vater half ihnen kostenlos. Und am nächsten Tag, frühmorgens, kamen sie und legten etwas vor unsere Tür – zwei Hühner, ich weiß nicht was. (…) Mein Vater hatte jüdische Wurzeln. Aber er erzählte uns dieses Geheimnis erst, als ich etwa elf war. Davor wusste ich nichts davon. Im Sozialismus war es verboten, darüber zu sprechen. (…) Unser ursprünglicher Name war Korin, ein jüdischer Name. Mit diesem Namen hätte er nicht überlebt. Mein Großvater war sehr weise und änderte unseren Namen in Krasznahorkai. Krasznahorkai war ein irredentistischer Name. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Ungarn zwei Drittel seines Territoriums, und die Hauptpolitik der konservativ-nationalistischen Regierung nach dem Krieg bestand darin, diese verlorenen Gebiete wiederherzustellen. Es gab ein sehr berühmtes Lied, ein unerträglich sentimentales Lied über das Schloss Krasznahorka. Nach dem Krieg wurde es Teil der Tschechoslowakei. Die Essenz des Liedes ist, dass das Schloss Krasznahorka sehr traurig und düster ist und alles hoffnungslos. Vielleicht hat mein Großvater es deshalb gewählt. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es, denn er war ein sehr schweigsamer Mann. Das war 1931, vor den ersten ungarischen Judengesetzen.“
Ab 1960 besuchte Krasznahorkai die Grundschule, anschließend das Gymnasium in Gyula und von 1974 bis 1976 absolvierte er ein Jurastudium in Szeged und Budapest und studierte von 1977 bis 1983 in Budapest Ungarisch, Literatur und Volkskunde. Ungarn befand sich damals noch tief im Griff der sozialistischen Ordnung und Krasznahorkai gehörte zur Generation jener, die in einer Atmosphäre der ideologischen Enge aufwuchsen und die zugleich von den Verheißungen der Moderne, des Denkens, der Kunst und des Zerfalls fasziniert waren.
Im oben genannten Interview mit Thirlwell beschreibt er eindrücklich diese Atmosphäre: „Thirlwell: Ich erinnere mich, dass du einmal von dem Gefühl der Zeitlosigkeit gesprochen hast, das du immer spürst, und es mit dem Aufwachsen im Sowjetreich in Verbindung gebracht hast, das mit der Geschichte aufgeräumt hatte. Krasznahorkai: Es war eine zeitlose Gesellschaft, weil man einen glauben machen wollte, die Dinge würden sich nie ändern. Immer derselbe graue Himmel und farblose Bäume und Parks und Straßen und Gebäude und Städte und Dörfer, und die schrecklichen Drinks in den Bars und die Armut und die Dinge, die man nicht laut aussprechen durfte. Man lebte in einer Ewigkeit. Es war sehr deprimierend. Meine Generation war die erste, die nicht nur nicht an die kommunistische Theorie oder den Marxismus glaubte, sondern sie lächerlich und peinlich fand. Als ich das Ende dieses politischen Systems miterlebte, war es ein Wunder. Ich werde den Geschmack der politischen Freiheit nie vergessen. Deshalb habe ich jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft, denn für mich bedeutet die Europäische Union vor allem politische Freiheit gegen die aggressive Dummheit, die heute der Gott Osteuropas ist“ (Paris Review 225, Sommer 2018).
Satanstango
Bekannt wurde László Krasznahorkai mit seinem ersten Roman „Satanstango“ („Sátántangó“, 1985), die Geschichte eines heruntergekommenen Dorfes, verloren in einem endlosen Regen. Einige Menschen, eher armselige Gestalten, warten auf die Rückkehr eines Mannes, der ihnen Erlösung verspricht. Doch die Erlösung ist Betrug, der Prophet ein Schwindler, und die Hoffnung nichts als ein Ritual der Selbsttäuschung. Man kann dieses Buch durchaus als Parabel auf die postsowjetische Gesellschaft lesen, als ein politisches Gleichnis des späten Sozialismus. Aber es ist auch mehr – eine eigenwillige Darstellung, eine Analyse, eine Meditation über das Wesen des Glaubens, über das unerschütterliche Bedürfnis, doch an etwas zu glauben, selbst wenn es einen vernichtet. Schon hier in seinem Romandebüt ziehen sich die Sätze endlos mäandernd dahin, sich in Klammern verschachtelnd, in einem unaufhörlichen Rhythmus, einem Bewusstsein geschrieben, das keine Luft holen darf. Als Leser fühlt man sich schon nach wenigen Seiten hineingezogen in eine Realität, in der Hoffnung und Täuschung, Glaube und Betrug ununterscheidbar ineinanderfallen.
Der Roman, der mittlerweile schon Klassikerstatus erreicht hat, ist eine grandiose Parabel über die Macht der Illusion – und über die unaufhaltsame Anziehungskraft des Untergangs. Sein Bruder im Geist, der Filmemacher Béla Tarr machte daraus später einen monumentalen, fast siebenstündigen Film, der die Qual und Schönheit von Krasznahorkais Prosa kongenial in Schwarz-Weiß übersetzte.
„Die Melancholie des Widerstands“ („Az ellenállás melankóliája“, 1989) beginnt auf einem Bahnhof in einer abgelegenen Gegend Ungarns. Eine Menschenmenge wartet auf den Schnellzug, der nicht kommt. Niemand weiß, warum oder wo er ist. Als Ersatz kommt spät, aber doch ein klappriger alter Zug. Die zierliche Frau Plauf, die eigentlich erste Klasse fährt, muss sich nun unter den Pöbel mischen. Diese Leute reden laut, spielen Karten, essen und trinken lärmend, fluchen und erzählen obszöne Witze. Frau Plauf war zweimal verheiratet und lebt in einer schönen Wohnung. Ihr erster Mann war Alkoholiker. Sie hatten einen Sohn, János Valuska, einen Jungen, der immer auf der Flucht war, immer unterwegs; ohne Aussicht auf Besserung. Mutter und Sohn sind mehr oder weniger entfremdet, und er scheint der Dorftrottel zu sein, obwohl, wie man sehen wird, die Sache komplizierter ist. Ihr zweiter Mann ist leider gestorben. Sie ist jetzt 58 und froh, ihrem Sohn, der ihr das Leben schwer gemacht hatte, entkommen zu sein und allein leben zu können.
Ihr Sohn János Valuska, der nie richtig erwachsen geworden ist und sich jeden Abend im Gasthaus zum Gespött macht, steht im Zentrum der Geschichte. Er erklärt den Säufern das Universum. Als Einziger in der kleinen Stadt sieht und versteht er alles, erkennt die Brutalität der Mächtigen und die Aussichtslosigkeit des Widerstands– und geht schließlich daran zugrunde. Weil die Dinge schieflaufen im Universum, zumindest in Gyula. Gebäude scheinen auseinanderzufallen, ein riesiger Baum stürzt um, der Wasserturm wackelt scheinbar, überall liegt Müll wilde Katzen streunen herum. Die Vorräte gehen zur Neige und die lokale Regierung ist abwesend. Und dann taucht plötzlich ein Zirkus auf, mit einem ausgestopften Riesenwalfisch und einem zehn Kilogramm schweren „Herzog“ mit drei Augen, einer obskuren Führergestalt, die die Menschen fesselt und die Kontrolle übernimmt. Noch bevor die Bewohner:innen begreifen, was geschieht, stecken sie in einem apokalyptischen Strudel, es herrscht Chaos, oder Teufelswerk? Der groteske und unheimliche Roman kann als eine Art allegorischer Spiegel des moralischen Zerfalls gelesen werden.
Asiatische Seinsmeditationen
1987 verließ Krasznahorkai Ungarn und lebte mit einem DAAD-Stipendium für längere Zeit in Berlin. In den frühen 1990er Jahren reiste er – nicht nur geografisch, sondern auch geistig – nach China, in die Mongolei und nach Kyōto.
In „Der Gefangene von Urga“ (1993) wird eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China geschildert. Über die Mongolei reist der Erzähler, einer unerklärlichen Melancholie entfliehen wollend, ins Land und bleibt bei seiner Rückkehr auch dort, in Urga (das ist der alte Name für Ulan-Bator, der Hauptstadt der Mongolei). Er beschreibt die langwierige und eintönige Zugfahrt im mongolisch-chinesischen Grenzgebiet und seine Beobachtungen der mit ihm Reisenden. In China angekommen, erlebt er neben dem Reiz der Exotik auch die graue Alltagswirklichkeit und verliebt sich in eine Schauspielerin, die jedoch unnahbar bleibt. Der Text changiert zwischen Fiktion und Reiseessay und die langwierige Reise wird solcherart zu einer Wiederbegegnung mit sich selbst.
Als Ausgangspunkt für „Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss“ (2003) dient die Pilgerreise eines Enkels des Prinzen Genji, eines grüblerischen Einzelgängers, der in eine Wirklichkeit gerät, in der alle Logik und Kausalität außer Kraft gesetzt ist. Dieser Enkel erinnert Andreas Breitenstein (NZZ, 28.05.2005) an eine Anime-Figur aus Hayao Miyazakis Zeichentrickfilm „Chihiros Reise ins Zauberland“: „Beide Helden (und mit ihnen die Leser/Zuschauer) tappen im Dunkeln, angstvoll und doch seltsam aufgehoben in einer Balance von Spiritualität und Surrealität, die auch der komischen Momente nicht entbehrt.“ „Andächtig, fast weihevoll“ folgt Breitenstein der Initiationsgeschichte, die Krasznahorkai erzählt, und zeigt sich besonders beeindruckt von den Naturschilderungen, die zur „betörenden Seinsmeditation“ werden.
Besonders Japan wurde so zu einem Ort der Spiegelung für Krasznahorkai. Dies trifft auch für „Seiobo auf Erden“ (2008) zu, eine Sammlung von Geschichten, die sich um Kunstwerke und göttliche Epiphanien drehen – Betrachtungen des Schönen als etwas Unzugängliches, das den Menschen in seiner Unwürdigkeit überragt. Er folgt, um das Heilige zu suchen, der japanischen Göttin Seiobo, die sich in Kunstwerken, in Momenten der vollkommenen Form zeigt. Die Geschichten führen von Kyoto bis Athen, von Florenz bis zu einem Museum in Madrid. Immer geht es um dieselbe Frage: Wie kann man das Erhabene erkennen in einer Welt, die längst taub geworden ist? In einem wunderbaren Text beschreibt Krasznahorkai einen Restaurator, der in der Kirche der Annunziata das Gesicht einer Madonna freilegt – und in diesem Moment öffnet sich für ihn der Himmel. Hier lebt ein verzweifelter Glaube an das Erhabene fort, an die Kunst als einzige mögliche Form der Erlösung. Selbst im Chaos – vielleicht gerade dort – wird die Spur des Göttlichen gesucht, das Schreiben als Askese, aber auch Gebet.
Die Schrecken der Geschichte
Während Krasznahorkai an „Krieg und Krieg“ (1999) arbeitete, bereiste er weite Teile Europas und lebte eine Zeit lang in Allen Ginsbergs New Yorker Apartment. Die Unterstützung des legendären Beat-Poeten bezeichnete er als entscheidend für die Fertigstellung des Romans. Darin begibt sich Korim, Archivar und Privatgelehrter aus einer ungarischen Provinzstadt, auf eine Reise nach New York City, um dort zu sterben. Auf verschiedenen imaginären und realen Stationen (Budapest, Kreta, Venedig, Rom) unternimmt Korim eine Reise durch die Vergangenheit des Abendlandes und durchlebt nochmals die Geschehnisse und Schrecken der Geschichte, um sozusagen bei sich und seinem ersehnten Ende anzukommen. Für Klaus Dermutz ist das Buch in seiner Besprechung (Frankfurter Rundschau, 13.10.1999) nichts weniger als der „Abgesang auf die Geschicke der Menschheit“: „Der Mensch ist in Krasznahorkais radikaler Weltsicht ein bloße Verirrung der Schöpfung, eine pulsierende Masse von Fleisch und Knochen, gezeichnet von den Schrecken der Geschichte“.
Mit seinem späten Roman „Baron Wenckheims Heimkehr“ (2016), kehrt Krasznahorkai zurück nach Ungarn, in eine „Provinz der Verzweiflung“. Darin kommt ein greiser Baron heim, in der Hoffnung auf Liebe, und findet eine Stadt voller Absurdität, Gier und Lächerlichkeit vor. Es entfacht sich nun eine apokalyptische Komödie, in der seine Welt, dabei sich selbst parodierend, auseinanderfällt. Man könnte den Roman durchaus als den Abschluss einer Trilogie des Untergangs („Satanstango“, „Melancholie“, „Wenckheim“) sehen, drei Variationen über dieselbe Frage: Was bleibt, wenn alles Sinnhafte verschwunden ist?
Hauptperson im bislang letzten übersetzten Roman „Herscht 07769“ (2021) ist Florian Herscht, Alter unbekannt, der von einem Rechtsradikalen und Judenhasser, den alle nur „Boss“ nennen, aus dem Waisenheim geholt und aufgezogen wurde. Auf seine Briefe an die Bundeskanzlerin in Berlin aus dem fiktiven Ort Kana in Thüringen schreibt er „Herscht 07769“ ins Absenderfeld. Er will Angela Merkel von einem „naturphilosophischen Alarmsignal“ in Kenntnis setzen. Im Volkshochschulkurs „Die Physik auf modernen Wegen“ hat er nämlich Herrn Köhler, den Kursleiter, so verstanden, dass, kurz gesagt, das Universum aus quantenphysikalischer Sicht ein Fehler und deshalb dem Untergang geweiht sei. Aber das ist nur der Beginn in einer Eskalation der Ereignisse, in deren Zentrum der recht naive, wenn auch muskelstrotzende Bäckergeselle aus Kana steht. Seiner Einfalt zum Trotz geht er den Welträtseln weiter auf den Grund und findet eine Lösung bei Johann Sebastian Bach. Der überraschende, aberwitzige und dunkle Roman strotzt vor schrägem Humor.
Einen ebenfalls humoristischen, auf jeden Fall satirischen Ton schlägt auch der 2024 erschienene Roman „Zsömle Odavan“ an, der nun im Dezember auf Deutsch unter dem Titel „Zsömle ist weg“ erscheinen wird. Darin wird der 91-jährige Onkel Józsi Kada (trotz all seiner Bemühungen, aus dem Blickfeld der Welt zu verschwinden) von seinen Anhängern in einem namenlosen ungarischen Dorf gefunden. Seine Familie hat seine Herkunft jahrhundertelang geheim gehalten, dass nämlich der pensionierte Elektriker als Nachfahre von Béla IV. und Dschingis Khan unter dem Namen József I. aus der Árpáden-Dynastie den ungarischen Thron beanspruchen könnte. Er will sich nicht in die Politik einmischen, möchte seine hohe Abkunft weiterhin verbergen, doch seine begeisterten Jünger, darunter ein Monarchist und ein Möchtegernterrorist, wollen mit ihm das Königtum wieder einführen.
László Krasznahorkai, so der irische Autor Colm Tóibín, „beschäftigt sich mit Grenzen, mit dem, was passieren kann, wenn Sprache über ihre eigenen anständigen Regeln hinaus getrieben wird. Oder was passieren kann, wenn das Bewusstsein selbst in seinen Systemen als unendlich dargestellt wird und in der Lage ist, sich umzudrehen und sich selbst zu nähren, bevor es sich wieder vorwärts bewegt. Oder was passieren kann, wenn Wissen, Handeln, Erinnerung oder Stimme sich nicht so leicht durch Erzählungen bändigen lassen. Aus diesem Grund ist er als Geschichtenerzähler fasziniert von Extremen, von der Möglichkeit einer Apokalypse“ (The Guardian, 10.10.2025).
Als er 2015 den Man Booker International Prize entgegennahm, bedankte sich Krasznahorkai bei seinen Leser:innen und (unter anderen) Franz Kafka, Ernő Szabó und Imre Szimonyi, „unbekannten Dichtern meines Geburtsorts Gyula“, dem mystischen Schriftsteller János Pilinszky, Fjodor Dostojewski, seiner ersten und zweiten Frau, Jimi Hendrix, Thelonious Monk, seinen amerikanischen, britischen und deutschen Verlegern, der Stadt Kyoto, Thomas Pynchon, seiner Mutter, seinen Übersetzern, „Max“ Sebald, der ungarischen Sprache, Gott. Damit zeichnete er eine ziemlich genaue Karte einer Weltliteraturlandschaft, die man wohl auch als seine Heimat wird bezeichnen dürfen.
Foto: © Nina Subin