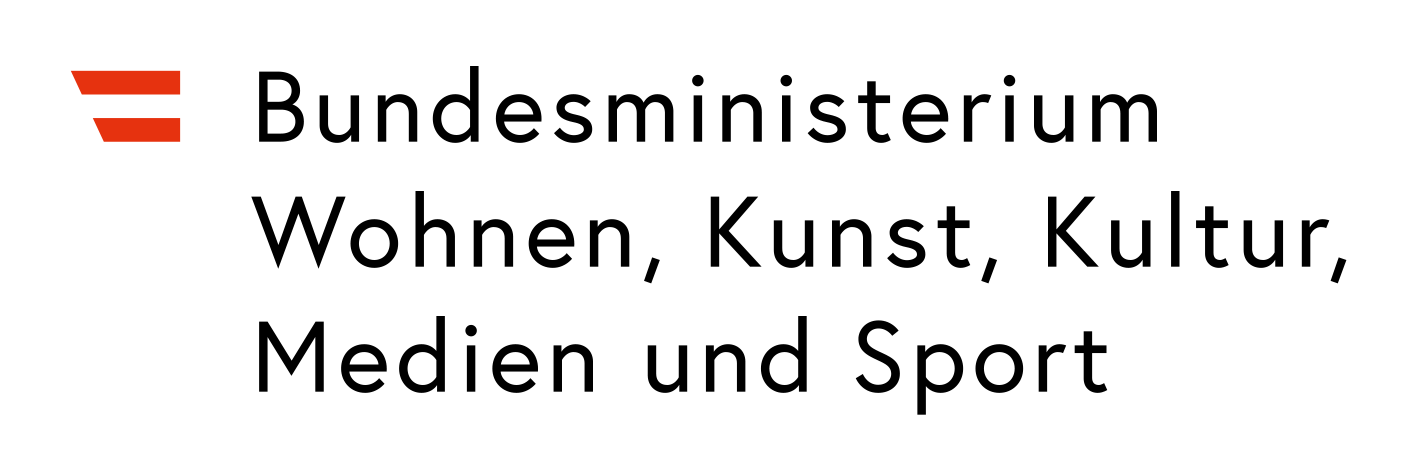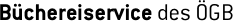Louise Glück - Wasser in Blut verwandeln

Veröffentlicht am 13.11.2020
Peter Klein über Louise Glück, Nobelpreisträgerin für Literatur 2020
In den Listen der Wettbüros, die in den letzten Jahren die späteren Preisträger des Literaturnobelpreises stets vorne gereiht hatten (selbst Bob Dylan wurde mit einer Quote von 25:1 angeboten), kam die nun mit dem Literaturnobelpreis 2020 ausgezeichnete US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück überhaupt nicht vor. Auch war sie bislang außerhalb der USA, wo sie mit den höchsten Preisen auszeichnet wurde, kaum bekannt und schon gar nicht präsent. In deutscher Übersetzung erschienen auf Initiative der deutschen Autorin Ulrike Draesner die von ihr übersetzten Gedichtbände „The Wild Iris“ und „Averno“.
Die Juroren der Schwedischen Akademie verliehen ihr den Nobelpreis für Literatur 2020 „für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht“.
Ihre Gedichte kommen klar und einfach daher. Sie scheinen bei allzu schneller Lektüre auf eine Weise sperrig zu sein, bis man in die unheimlichen Tiefen ihrer Dichtung starrt und sich fragt, welche Kräfte unterhalb der unschuldigen Oberfläche wirken. Eine besonders treffende Charakterisierung ihrer Kunst fand der amerikanische Kritiker Adam Plunkett. Glück, so schrieb er in der „New Republic“ über ihre 2012 erschienenen „Collected Poems“ (Farrar, Strauss & Giroux), sei eine der wenigen Schriftstellerinnen, denen es gelinge, Wasser umstandslos in Blut zu verwandeln.
Louise Glück wurde 1943 als Enkelin ungarisch-jüdischer Einwanderer in New York geboren. Ihre jüdischen Großeltern väterlicherseits stammten aus Ungarn und besaßen nach ihrer Einwanderung in die USA ein Lebensmittelgeschäft in New York. Ihr Vater war bereits in den USA geboren. Ihre Mutter war russisch-jüdischer Abstammung und Absolventin des Wellesley College.
Louise wuchs auf Long Island auf. In ihrer Kindheit brachten die Eltern ihr die griechische Mythologie und klassische Stoffe nahe. Schon in jungen Jahren schrieb sie Gedichte. Als Teenager entwickelte Glück eine Anorexia nervosa, eine nervlich bedingt Essstörung, deren Ursache sie in einem Aufsatz als den Versuch beschrieben hat, sich von ihrer Mutter zu lösen. An anderer Stelle hat sie ihre Krankheit mit dem Tod einer älteren Schwester in Verbindung gebracht, ein Ereignis, das vor ihrer Geburt stattfand. Von ihrem Abschlussjahr an der George W. Hewlett High School in Hewlett Bay Park, New York, an begab sie sich sieben Jahre lang in psychoanalytische Behandlung.
Sie studierte am Sarah Lawrence College und an der Columbia University. 1967 heiratete sie Charles Hertz Jr. Die Ehe wurde jedoch bald darauf geschieden. Nach dem Erscheinen ihres ersten Gedichtbands „Firstborn“ im Jahre 1968 litt sie an einer Art Schreibblockade, die sie erst überwand, als sie 1971 eine Dozentur am Goddard College, einer Privatschule in Plainfield, Vermont, annahm. Anschließend hatte sie zwanzig Jahre lang eine Professur am Williams College inne. 1973 bekam sie mit ihrem damaligen Partner John Dranow, einem Autor, der das Sommer-Schreibprogramm am Goddard College begonnen hatte, einen Sohn, Noah. 1977 heiratete sie John Dranow, die Ehe hielt bis Ende der 1990er Jahre. Von 1999 bis 2003 gehörte Louise Glück dem ehrenamtlichen Board of Chancellors der Academy of American Poets an. Seit 2004 ist sie Rosenkranz Writer in Residence und Professorin für Englisch an der Yale University. Sie wurde schließlich mit den bedeutendsten Preisen des amerikanischen Literaturbetriebes ausgezeichnet – unter anderem mit dem Pulitzer Prize (1993), dem Bollingen Prize (2001) und dem National Book Award (2014). 2016 erhielt sie im Weißen Haus aus den Händen von Barack Obama die Medaille für Geisteswissenschaften.
Wenn dennoch die meisten europäischen Leserinnen und Leser noch nichts von ihr gehört haben, dann möglicherweise weniger, weil sie andere Formen zeitgenössischer Dichtung bevorzugen, sondern vielmehr, weil sie andere literarische Formen lesen. Einige Kritiker wiesen auch dezidiert darauf hin, dass ihre Lyrik konservativ und streng sei, in der „Süddeutschen Zeitung“ ließ man sich sogar dazu hinreißen, „Kitschalarm“ auszurufen. Davon kann keine Rede sein.
Louise Glück zählt seit Jahrzehnten zu den herausragenden englischsprachigen Poeten der Gegenwart. In ihren Werken wie „The Wild Iris“ (1992), „Vita Nova“ (1999) oder der Werkschau „Poems 1962-2012“ oder zuletzt „Faithful and Virtuous Night“ (2014) fängt sie nicht zuletzt in gewissem Sinne die momentane Stimmung (nicht nur) amerikanischer Existenznöte und -freuden menschlicher Individuen ein sowie manchmal auch nicht-menschlicher Individuen, wie in „The Wild Iris“, indem Blumen zum lyrischen Ich sprechen.
In Glücks Versen verschwimmt oft die Grenze zwischen Dichterin und lyrischem Ich und so werden einschneidende Erlebnisse wie der Verlust des Vaters in dem Band „Ararat“ (1985) thematisiert. Die direkte, klare Sprache der langjährigen Universitätsprofessorin ist allerdings zu keinem Zeitpunkt mit einer bloßen Tagebuchdichtung zu verwechseln, wie die komplexen Verästelungen von persönlicher Reflexion und mythologischen Bezügen auf antike Gestalten (wie Persephone in ihrem Werk „Averno“) bezeugen. Die Konstruktion eines lyrischen Selbst in Glücks Poetik ist vielmehr ein Wechselspiel zwischen kathartischer Form und formaler Distanz.
Tatsächlich mischt sich in die sprachliche Klarheit ihrer Gedichte etwas atmosphärisch Undurchlässiges, das bis zur völligen Verdunklung reichen kann. Im Fall von „The Drowned Children“ („Die ertrunkenen Kinder“) entfachte es regelrechte Kontroversen, ob sie mit ihren Zeilen Kindern nicht Gewalt antue. So beginnt das umstrittene Gedicht: „You see, they have no judgment. / So it is natural that they should drown, / first the ice taking them in / and then, all winter“ („Siehst du, sie haben kein Urteil. / Also ist es natürlich, dass sie ertrinken, / während erst das Eis sie verschluckt / und dann der ganze Winter“).
In „The Night Migrations“ (Die nächtlichen Wanderzüge), dem Auftaktgedicht ihrer Sammlung „Averno“, führt in den nur drei Strophen der „nächtlichen Wanderzüge“ der Weg von der Feier der sinnlichen Wahrnehmung über die Melancholie ihrer Endlichkeit bis in die Imagination eines Totenreichs, dem selbst der Blick zurück ins Lebendige verwehrt bleiben muss: „Dies ist der Augenblick, in dem du / die roten Beeren der Eberesche wiedersiehst, / und am dunklen Himmel / die Vögel beim nächtlichen Wanderzug. // Es bedrückt mich zu denken, / dass die Toten sie nicht sehen - / diese Dinge, die uns selbstverständlich sind, / sie entschwinden. // Was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten? / Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr; / vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein, / so schwer vorzustellen das auch ist.“
Louise Glück, die ein enges Verhältnis zur Psychoanalyse hat, weiß, wie man zerstörerische Energien kanalisiert. Man kann ihre Texte auf Biografisches beziehen, die jugendliche Magersucht und die beiden schwierigen, bald geschiedenen Ehen. Doch die Verwandlung ist offensichtlich, und dass sie in ihren Texten einen Wesenskern berührt, an den sie in der sprachlichen Vermittlung zugleich nicht heranreicht, macht das literarische Kippmoment von Nähe und Distanz in ihren Gedichten aus. Das Autobiografische entzündet auch eher das Konstruktive ihrer Dichtung. So lebt der Band „Wilde Iris“ von einer wunderbaren Dreistimmigkeit: dem Gespräch der Blumen mit dem Gärtner, den Worten des dichtenden Gärtners und einer Gottesfigur, die diese Schöpfung überschaut.
Die amerikanische Dichtung ruht auf zwei Grundsäulen. Die eine ist Walt Whitman, der mit starker Stimme und musikalischer Kraft weit ausgreifende Formen in freien Rhythmen schuf, wie sie die „Leaves of Grass“ auszeichnen. Die andere ist Emily Dickinson, die in kleinen, übersichtlichen, den Reim nicht scheuenden Formen die schwierigsten Themen mit oft trügerischer Eingängigkeit verhandelte: die Gottesidee und das Gehirn, das sie ausspinnt, oder das Bewusstsein und seine Abwesenheit im Tod.
Beide verbindet eine Leidenschaft für die Natur und deren Beschwörung, doch sie sind einander nie begegnet. Dickinson führte im Hause ihres Vaters in Amherst, Massachusetts, ein einzelgängerisches Dasein. Und während Whitman nichts von Dickinson lesen konnte, weil sie zu Lebzeiten nur eine Handvoll Gedichte veröffentlichte, hatte sie zu Whitmans Gedichten in der Bibliothek ihres ansonsten büchernärrischen Vaters wohl nicht einmal Zugang: Sie galten ihm als obszön.
Unter diesen Gründungsfiguren gehört Louise Glück, auch wenn ihr der Reim fremd blieb, unbedingt auf die Seite von Emily Dickinson. Das ist sicher auch eine Geschlechterfrage. Vor allem aber hat es mit einer Haltung zu tun, die sich nicht der Welt und ihren politischen Geschäften in die Arme wirft, sondern sowohl aus der Distanz zum Getriebe wie aus dem Innersten der eigenen Seele die Dinge zu ergründen sucht.
Dazu kommen intime Kenntnisse der griechischen Mythologie, die sie aber nicht bildungshuberisch ausbreitet, sondern dazu einsetzt, sich der Tatsache zu vergewissern, dass es trotz der Einzigartigkeit jeder menschlichen Erfahrung Vorformen gibt, in denen man die eigenen Fährnisse wiedererkennt. Das wiederum führt zu der ebenso oft angestellten wie widerlegten Beobachtung, dass Glück ein „confessional poet“ sei, also jemand, der hemmungslos Ich sagt und den eigenen Lebensstoff ausbeutet. Die Bezeichnung knüpft sich an Sylvia Plath und, mehr noch, an Robert Lowell und Elizabeth Bishop an, deren dichterische Klarheit sie in vielem teilt. Und Louise Glück ist eine Dichterin der Traumata, des Begehrens, der Angst, der Vereinzelung und Vereinsamung. Alles, was sie schreibt, ist mühsam gebändigte Emotion, aus der das Allgemeingültige ihrer Verse kommt.
Foto: Luchterhand Verlag