Mario Vargas Llosa - Der klarsichtige Analytiker und furchtlose Störenfried
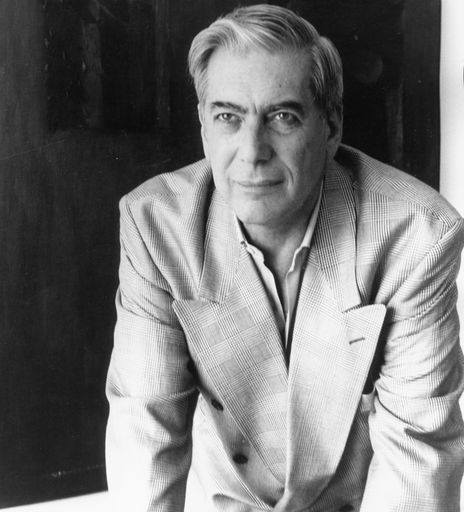
Veröffentlicht am 08.06.2020
Von Robert Leiner
Als die Schwedische Akademie ihm, der so lange auf die Auszeichnung warten musste, 2010 den Nobelpreis zugesprochen hat, war der Preis berechtigt, ja überfällig. Mario Vargas Llosa, nach Gabriel García Márquez der wichtigste lateinamerikanische Autor des letzten Jahrhunderts, musste seinem früheren Freund und späteren Konkurrenten, ja Feind, stets den Vortritt lassen. García Márquez kam immer vor ihm, den Nobelpreis erhielt er schon 1982. Vor allem aber galt García Márquez, der Rebell, Widerständler und Castro-Freund, als der linke Weltoffene, und Vargas Llosa, der intellektuelle Maßanzugträger, der mit den Mächtigen speist, als der konservative Angepasste. Doch dieses Bild ist grundfalsch. Zwar wurden die beiden über ihre politischen Ansichten zu Feinden (García Márquez kämpfte gegen die rechten lateinamerikanischen Diktatoren, Vargas Llosa gegen die rechten und die linken), doch beide sind große Aufklärer, sowohl in ihren Werken als auch in ihrem politisch-gesellschaftlichen Wirken.
Mario Vargas Llosa, 1936 in Arequipa im peruanischen Hochland geboren, kommt, allem Anschein zum Trotz, nicht aus einem begüterten Elternhaus. Sein Vater Ernesto Vargas Maldonado war Telegraphist und Flugplatzfunker der Panagra-Gesellschaft in Tacna, einer Distriktshauptstadt im Süden Perus, und seine Mutter Dora Llosa Ureta stammte aus einer aus Spanien kommenden Mittelschichtfamilie. Die Eltern hatten sich schon vor der Geburt ihres Sohnes getrennt. Nicht zuletzt wegen ihrer schwierigen Situation als Alleinerziehende übersiedelte sie mit ihren Eltern und ihrem damals einjährigen Sohn nach Cochabamba in Bolivien. Dort verbrachte Mario Vargas Llosa seine Kindheit und absolvierte die Grundschule am katholischen Colegio La Salle. Unter der Regierung von José Luis Bustamante y Rivero wurde sein Großvater mütterlicherseits Präfekt in der nordperuanischen Stadt Piura, wo sich dann die gesamte Familie niederließ. 1946, im Alter von zehn Jahren, lernte er seinen Vater kennen, worauf er zusammen mit seiner Mutter zu ihm nach Lima zog. Er besuchte weiterhin Schulen der Salesianer Don Boscos, bevor ihn sein Vater zwang, für zwei Jahre eine Militärschule in Callao (benachbart der Hauptstadt Lima) zu besuchen. Zu seinem Vater hatte er ein sehr schwieriges Verhältnis: „Mein Vater ist mir immer wie ein Fremder vorgekommen, der mich mit seiner Autorität niederschmetterte. Da bin ich vor der verhassten Wirklichkeit ins Reich der Fantasie geflüchtet und habe mir eine Ersatzwelt geschaffen. So lässt sich vielleicht am besten erklären, wie ich zum Schriftsteller geworden bin.“
Das letzte Jahr seiner Schulausbildung verbrachte er in Piura, im Norden Perus, wo er, wie bereits zuvor in Lima, nebenbei in der Redaktion einer Lokalzeitung mitarbeitete und sein erstes Theaterstück „Die Flucht des Inka“ zur Aufführung bringen konnte. Nach dem Schulabschluss begann er in Lima gleichzeitig ein Jura- und ein Literaturstudium an der Nationale Universität San Marcos; Letzteres schloss er ab. Seine schriftstellerische Betätigung nahm in dem Maße zu, wie seine Tätigkeit als Journalist nachließ.
Mit 19 Jahren heiratete er in Lima Julia Urquidi Illanes, die Schwester einer Schwägerin der Mutter. Die Ehe blieb kinderlos und wurde 1964 geschieden. 1959 konnte er mit einem Stipendium an der Universität Complutense in Madrid in Philosophie und Literatur promovieren. Im selben Jahr erschien auch sein erstes Buch, sechs Erzählungen, „Los jefes“ („Die Anführer“) in Spanien. „Die Anführer“, das sind die Chefs zweier um die Vorrangstellung rivalisierenden Schülerbanden im Salesianerkolleg in Piura, die sich gegen den autoritären Direktor auflehnen. In der Erzählung „Der jüngere Bruder“ jagen und töten zwei Brüder einen Indio, der – in ihren Augen und nach ihrem gesellschaftlichen Kodex – ihre Schwester belästigt hat. Was für den jüngeren Bruder wie eine erwünschte Bewährung erscheint, wird zur Initiation in die Ausübung männlicher Gewalt. Mario Vargas Llosa, gerade 23 Jahre alt, hat hier bereits den Ton und das Thema seiner weltberühmten Romane gefunden. Es geht um den Einzelnen und die Kräfte, die auf ihn einwirken, um ihn in die geltenden gesellschaftlichen Verhaltensweisen einzuüben, und um das, was er dagegenzusetzen hat: Freundschaft, die stets prekäre Solidarität der Gruppe, einen persönlichen Kodex von Moral und Ehre.
Nur wenige Jahre später, 1963, gelang ihm der internationale Durchbruch mit dem Roman „La ciudad y los perros“ („Die Stadt und die Hunde“), in dem er seine Erfahrungen in der Militärschule verarbeitete. Mit Stadt ist Lima gemeint, mit den Hunden die Kadetten. Erzählt werden die Ereignisse in der peruanischen Kadettenschule Leoncio Prado, deren totalitäres System sich langsam aus den verschiedenen Fragmenten zusammensetzt, die eine lineare Lektüre unmöglich machen.
Darin versteckt sich eine überschaubare Fabel. 16- bis 17-jährige Schlägertypen (allen voran die vierköpfige Maffia, bestehend aus dem Anführer Jaguar und den Bandenmitgliedern Porfirio Cava, dem Boa und dem Löckchen) peinigen ihren Kameraden Ricardo Arana bis aufs Blut. Ricardo, von ihnen „Sklave“ genannt, steckt nur Prügel ein und erhält außerdem von den Vorgesetzten eine Strafe nach der anderen. Die Maffia betreibt einen Handel mit Spick-Zetteln mit wichtigen Prüfungsfragen und verkauft diese an Kameraden. Ricardo, der zum Zeitpunkt des Diebstahls von Chemie-Fragen Wache gestanden hatte, meldet Cava bei einem vorgesetzten Leutnant und erhält zur Belohnung Ausgang. Cava wird relegiert. Er nimmt alle Schuld auf sich, obwohl er vom Jaguar angestiftet worden war. Während der nächsten Feldübung mit scharfer Munition wird Ricardo hinterrücks in den Kopf geschossen und stirbt drei Tage darauf.
Nach dem Tode Ricardos sucht dessen Freund Alberto verzweifelt den Todesschützen und beschuldigt vor den Vorgesetzten den Jaguar der Tat. Die militärische Führung der Schule will mit Hilfe eines unwahren ärztlichen Gutachtens den Schuss als Unfall darstellen. Ricardo soll sich selbst angeschossen haben. Alberto wird von dem Schulleiter, einem Oberst, genötigt, seine Anschuldigung zurückzunehmen. Da Alberto seine Behauptung nicht beweisen kann, wird alles vertuscht. Das Buch erregte großes Aufsehen und ein Jahr später wurden tausend Exemplare des Romans auf dem Hof der Kadettenanstalt Leoncio Prado in Lima verbrannt – Strafe der Militärs für einen Autor, der als Jugendlicher direkt am Ort der Handlung ausgebildet wurde.
1965 heiratete er in Lima seine Cousine Patricia Llosa, die er an der Pariser Sorbonne kennengelernt hatte und mit der er drei Kinder hat: Álvaro Vargas Llosa, Schriftsteller, Gonzalo und Morgana, Fotografin. Er ließ sich in Paris nieder und arbeitete zusammen mit seiner damaligen Frau für France Télévisions sowie als Journalist für die Nachrichtenagentur AFP. Später zog er mit seiner Familie nach London und nach Barcelona. Erst 1974 kehrte er als Leiter und Moderator eines politischen Programmes im Fernsehen nach Peru zurück.
Mit dem 1966 erschienenen Roman „La casa verde“ („Das grüne Haus“) wurde er zum Autor von Weltrang. Die diskontinuierliche, die Perspektiven und Zeiten stets wechselnde Schreibweise, die vom Leser eine ständige Neuorientierung verlangt, bestimmt auch seinen zweiten Roman“ dergestalt, dass der Leser jegliche Orientierung verliert. Sind in "Die Stadt und die Hunde" die einzelnen Episoden noch fein säuberlich getrennt, befinden sich in "Das grüne Haus" die Schnittstellen in einzelnen Absätzen. Ja, gar in einzelnen Sätzen folgt ein Wechsel von szenischen Elementen, Erinnerungsfetzen, Umgangssprache und hohem Erzählton. Vargas Llosa selbst, inspiriert etwa von William Faulkner und Jean-Paul Sartre, betrachtet diesen Text als seinen Versuch, den „totalen Roman“ zu schreiben, also im Text die Vielschichtigkeit einer zersplitterten Wirklichkeit möglichst vollständig einzufangen. Es enthält eine Vielzahl von Orten und Gestalten, die miteinander verwoben sind. Es geht etwa um ein von Halbstarken besuchtes Bordell (eben das grüne Haus), Dörfer von Indios, deren Kinder geraubt und missioniert werden, oder um einen schwerkranken Gauner, der noch einmal sein Leben erzählt. Das grüne Haus, das Bordell, symbolisiert den Einbruch des Irrationalen in eine vorgeblich zivilisierte Ordnung wie die der Stadt. Gleichzeitig jedoch dringt die Zivilisation durch ihre Repräsentanten wie Nonnen und Soldaten immer tiefer in den Dschungel ein.
In der Erzählung „Los cachorros (Pichula Cuéllar)“ („Die jungen Hunde“) erzählt er von fünf Schulkameraden. Einer von ihnen, der kleine Cuéllar, wird nach einem Fußballspiel von einer Dogge namens Judas, die in den Umkleideraum der Schule ein dringt, entmannt. Kein Arzt kann helfen. Der begüterte Vater wendet sich jahrelang auch an ausländische Spezialisten – ohne Erfolg. Nach dem Unfall bleiben die Lehrer, Eltern und auch seine vier Schulfreunde Lalo, Choto, Mañuco sowie Chingolo nachsichtig-besorgt. Die Freunde geben Cuéllar den Spitznamen Schwänzchen. Mit der Zeit gewöhnt er sich an den Namen und stellt sich sogar neuen Schülern als „Schwanz Cuéllar“ vor.
Nach Jahren, als die vier Freunde einer nach dem andern ein Mädchen erobern, redet Cuéllar auf einmal schlecht über die Freundinnen und zieht sich somit den Groll seiner Schulkameraden zu. Die Freunde wollen Cuéllar eine Freundin verschaffen. Doch daraus wird nichts, seine Exaltationen nehmen zu. Er rast mit seinem Ford Cabriolet, einem Geschenk des Vaters, wie ein Irrer durch Lima, geht Mädchen aus dem Weg und fängt zu stottern an.
Alles wendet sich zum Guten, als die schöne, blonde Teresita Arrarte seine Annäherung duldet. Doch Cuéllar hält sich ihr gegenüber zurück, gibt sich ansonsten immer exzentrischer und überspannter. Nachdem Teresita einen anderen erhört hat, treibt sich Cuéllar immer öfter mit zwielichtigen Typen herum. Seine Freunde heiraten ihre Freundinnen, diplomieren als Ingenieure und er stirbt nach einigen schlimmen Autounfällen „in den üblen Kurven von Pasamayo“ bei seinem letzten Unfall. Vargas Llosa zeigt, wie der sexuell verstümmelte Cuéllar nach und nach vernichtet wird. Er kann nie „ein ganzer Mann“ sein und ist unfähig, einen anderen Lebensinhalt zu finden.
Sein dritter großer Roman „Conversación en La Catedral“ („Gespräch in der ›Kathedrale“) aus dem Jahr 1969 ist ein Porträt Perus unter der Diktatur Manuel A. Odrías in den 1950er Jahren und beschreibt das Leben in verschiedenen sozialen Schichten. Eines der großen Themen des Romans ist der Ekel des „jammervollen Bürgersöhnchens“ Santiago Zavala vor der korrupten Odría-Regierung (1948-1956). Es ist wohl sein komplexester Roman. Anhand eines Gesprächs von Santiago Zavala, des Sohnes eines Ministers, mit Ambrosio, dem ehemaligen Chauffeur seines Vaters, in der Bar „La catedral“ werden mehr als 70 Einzelschicksale über einen Zeitraum von 14 Jahren beschrieben. Dabei repräsentiert Santiago, der die Wahrheit über die Verstrickungen seines Vaters in Machenschaften des diktatorischen Regimes von Manuel Apolinario Odría Amoretti herausfinden möchte, die Ohnmacht der lateinamerikanischen Intellektuellen. Der aus dem kriminellen Milieu stammende ehemalige Diener Ambrosio mit seiner gemischtrassigen Herkunft (seine Mutter ist indigen indianisch und sein Vater ein Schwarzer) steht für das „einfache Volk“. Vargas Llosa gelingt hier eine relativ umfassende Darstellung der peruanischen Gesellschaft, und er entwirft das Bild einer korrupten und unfähigen einheimischen Bourgeoisie.
Nach „Conversación en la catedral“ rückt Vargas Llosa von seinem Konzept des Totalen Romans und teilweise auch von seinen bisherigen Themenschwerpunkten ab. „Pantaleón y las visitadoras“ („Der Hauptmann und sein Frauenbataillon“) von 1973 ist eine eher humoristisch und erotisch geprägte Satire. Der Roman spielt zwischen 1956 bis 1959 in Lima, Iquitos und Pomata am Titicacasee. Unter dem Einfluss des schwülheißen Dschungels versetzen die Soldaten der Kasernen im hinteren Amazonas-Gebiet die Bevölkerung mit ihren sexuellen Ausschweifungen in Panik und schaden dem Ruf der glorreichen peruanischen Armee. Also wird der untadelige Pantaleon mit der Planung und Durchführung einer Entlastungsoffensive betraut. Die Vehemenz des erotischen Tropenkollers soll sich auf soldatisch geordnete Weise entladen. Pantaleon soll einen „weiblichen Dienst“ einrichten, Pflichtgefühl und Liebe zur Armee nötigen den uniformierten Mustergatten, sich zum gewissenhaften Experten für sexuelle Ausschweifungen zu entwickeln. Sein heikler Geheimauftrag führt zu einer schrittweisen Eskalation der Situation und verursacht nicht nur komische Verwicklungen, die das Militär nicht mehr unter Kontrolle halten kann – es reißt den untadeligen Hauptmann Pantaleon auch aus der militärischen Routine und seinem brav bürgerlichen Familienleben.
Ein Höhepunkt in seinem Romanschaffen ist „La tía Julia y el escribidor“ („Tante Julia und der Kunstschreiber“, 1977), für Kenner und Verehrer Daniel Kehlmann „einer der lustigsten Romane aller Zeiten, ein Werk von derart hellem Witz und formalem Einfallsreichtum, zugleich eine Parodie auf die Trivialliteratur und aufs Schriftstellerdasein überhaupt.“
Im Lima der 1950er Jahre unter der Odría-Militärdiktatur liebt der junge Varguitas seine Tante Julia und macht erste Gehversuche als Schriftsteller. Sein erfolgreicher Kollege, der „Hörspielserienschreiber“ Pedro Camacho, verliert über der Schreibarbeit im Akkord den Verstand. Tante Julia ist eine attraktive 32-Jährige, die nach ihrer Scheidung in Lima auftaucht, wo sie einen neuen Ehemann zu finden hofft. Doch es kommt anders. Ihr eigener Neffe Mario verliebt sich in sie, ein gerade 18-jähriger Student, der mit einem Job bei einem Radiosender etwas Geld verdient und von seinem zukünftigen Leben als Schriftsteller in Paris träumt. Aus der anfänglichen Verliebtheit der beiden wird die große Liebe, die zum Skandal führt: Der Familienclan versucht, eine Heirat um jeden Preis zu verhindern. Mario und Tante Julia fliehen, und auf einer irrwitzigen Fahrt durchs Land suchen sie einen bestechlichen Bürgermeister, der den damals Minderjährigen mit seiner Tante traut.
Es ist eine turbulente Liebesgeschichte voller Verwicklungen – und nach dem Zeugnis des Autors bis in Einzelheiten autobiographisch (Mario Vargas Llosa war dann fünf Jahrzehnte mit der Tante liiert). Und die Geschichte verwebt sich in grotesker Weise mit den Radiohörspielen, die Marios Kollege beim Rundfunk, Pedro Camacho, pausenlos in die Schreibmaschine hämmert. Diese von ganz Peru begeistert verschlungenen Serien leben von Inzest, Familientragödien, keuscheste Liebe und Verführungskünste von Nymphchen. Fasziniert lauscht ihm Mario, der sich an eigenen Erzählungen versucht. Ein grandios-witziger, gerissener Roman, in dem anhand der beiden Schreiber nicht zuletzt dem Verhältnis zwischen Alltag und Kunst, zwischen Massenliteratur und anspruchsvollerer Prosa nachgespürt wird.
Im historischen Roman „La guerra del fin del mundo“ („Der Krieg am Ende der Welt“) von 1981 geht es um die Zerschlagung einer von Staat und gelenkter Presse zur nationalen Bedrohung hochstilisierten religiösen Sekte.
Ende des 19. Jahrhunderts wird in Brasilien die Monarchie abgeschafft, die junge Republik versucht, sich zu konsolidieren. Ein Wanderprediger, Ratgeber genannt, zieht durch die von Hungersnöten, Seuchen und chronischer Armut geplagten Gegenden und verkündet das Ende der Welt. Eine Schar von Ausgestoßenen, der Ärmsten im Lande, sammelt sich um ihn, fest entschlossen, den wahren Glauben gegen den Antichrist zu verteidigen, der die Menschheit verderben will. Dieser Antichrist ist: die Republik. Sie gründen in Canudos die „Gesellschaft der Ärmsten«“, ein „neues Jerusalem“. Mit Brüderlichkeit und Solidarität wollen sie Widerstand leisten. Die Aufständischen haben jedoch alle gegen sich: die um ihre Autorität besorgte Kirche, einen patriarchalischen Feudalherrn, zwei um die eigene Macht kämpfende Republikaner, den Revolutionär Galileo Gall. Sie alle reagieren mit Angst auf die Gründung des »neuen Jerusalems«. Die gesamten brasilianischen Streitkräfte werden schließlich aufgeboten, um die Anhänger des Ratgebers brutal zu vernichten. Als Vorlage dieses großen Romans mit wahrhaft infernalischen Bürgerkriegsszenen diente der tatsächlich stattgefundene Krieg von Canudas und das Buch „Krieg im Sertão“ von Euclides da Cunha darüber (ihm widmete Vargas Llosa auch den Roman).
Vargas Llosa wandte sich mehr der Politik zu. Im Gegensatz zu den meist linksgerichteten anderen südamerikanischen Intellektuellen jener Zeit vertrat Vargas Llosa, der sich von seinen eigenen linken Positionen ab den 1960er Jahren distanzierte, überzeugt liberale Positionen. Seine durch die Zerschlagung des Prager Frühlings endgültig bedingte Abkehr vom Sozialismus hat eine verstärkte Kritik der Praktiken sozialistischer, lateinamerikanischer Regime und Terrororganisationen in seinen Werken zur Folge.
„Historia de Mayta“ („Maytas Geschichte“, 1984) beschäftigt sich zum Beispiel mit einem aus einer kommunistischen Gruppierung (wohl Sendero Luminoso) ausgeschlossenen Revolutionär. Es ist die Biographie dieses vergessenen Revolutionärs und zugleich eine Romanabhandlung darüber, dass das Biographieschreiben unmöglich ist, bis im letzten Kapitel Vargas Llosa und sein Objekt, der ehemalige Guerrilla Mayta, jetzt Eisverkäufer am Strand Limas, einander ratlos gegenüberstehen und alles in Wahrheit ganz anders war, als man gerade gelesen hat. Auch hier ist die Schwierigkeit und Fragwürdigkeit der Rekonstruktion von Wahrheit durch aufwändige Reisen und Recherchen ein zentrales Thema.
In „El hablador“ („Der Geschichtenerzähler“, 1987) berichtet ein Ich-Erzähler, der deutliche Züge des Autors Vargas Llosa trägt, die Geschichte eines Freundes, des jüdischstämmigen Saúl Zuratas, der von den peruanischen Urwaldindianern der Machiguenga fasziniert seine Identität aufgibt und sich in das Nomadenvolk integriert. Saúl wird zu einem Geschichtenerzähler, einer Institution dieses Volkes und gibt die Mythen des Volkes weiter, indem er durch den Urwald zieht und die versprengten Gruppen und Familien der Machiguenga aufsucht, um sie mit Geschichten zu unterhalten. Auf diesem Weg bewahren sie ihre Traditionen, die sie vor der westlichen Zivilisation abschotten und ihre Nähe zur Natur erhalten. In dieser Dialektik von Naturnähe und Zerstörung durch die Industriegesellschaft ist die erzählerische Absicht des Buches zu finden: „Die Vorstellung des Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur, das Bewusstsein der Umweltzerstörung durch die Industriegesellschaft und die moderne Technologie, die Aufwertung des Wissens des Primitiven, der gezwungen ist, seinen Lebensraum zu respektieren, wenn er nicht untergehen will, ist eine Anschauung, die in jenen Jahren zwar noch keine intellektuelle Mode darstellte, aber doch schon allenthalben, selbst in Peru, Wurzeln zu schlagen begann.“
In seinen beiden an das Genre des Kriminalromans angelehnten Werken „¿Quién mató a Palomino Molero?“ („Wer hat Palomino Molero umgebracht?“, 1986) und „Lituma en los Andes“ („Tod in den Anden“) eliminiert Vargas Llosa viele inhaltlich und sprachlich entbehrliche Elemente. In „Wer hat Palomino Molero umgebracht?“ ist die Hauptfigur ein ermordeter mestizischer Soldat. Die geschilderten Nachforschungen ergeben nur, dass er nach seiner Flucht mit der Tochter eines Obersten von diesem anscheinend zu Tode gefoltert wurde. Auch hier bleibt wie in vielen Werken Vargas Llosas ab den 1970er Jahren die wirkliche Beziehung zwischen dem Oberst, der Tochter und dem Soldaten letztlich ungeklärt.
In „Lituma en los Andes“ („Tod in den Anden“, 1993) versuchen die beiden Polizisten einer abgelegenen Straßenbausiedlung, Korporal Lituma und sein Gehilfe Tomasito, das rätselhafte Verschwinden dreier Menschen aufzuklären. Der Roman ist von einer allgegenwärtigen Gewalt und Brutalität geprägt, ob von Seiten der Terroristen des Leuchtenden Pfades, der diese bekämpfenden Armee und Polizei, der Unterwelt einer Küstenstadt, der animistischen Vorstellungen und Riten der indigenen Bauarbeiter oder der mit ihren Unwettern und Bergstürzen bedrohlichen Natur selbst. Vargas Llosa gelingt es, die aktuelle peruanische Gewaltbereitschaft und gesellschaftliche Verrohung mit vorkolumbianischen Opferriten zu verbinden und einen (zum Beispiel in den Figuren des Kantinenwirts Dionisio und seiner Frau personifizierten) dionysischen, über Peru und die heutige Zeit hinausweisenden Urgrund von Gewalt und Inhumanität anzudeuten. Auch in diesem Buch stoßen Gegensätze aufeinander: auf der einen Seite der Spanisch sprechende Polizist Lituma, und auf der anderen die Quechua sprechenden Bewohner des Hochlandes. Doch nicht nur die unterschiedlichen Sprachen verhindern eine Kommunikation, vielmehr sind es, wie auch schon in „Das grüne Haus“, die unterschiedlichen, nebeneinander existierenden Realitäten Perus, die sich teilweise unversöhnlich begegnen.
In seiner autobiographischen Schrift „El pez en el agua“ („Der Fisch im Wasser“, 1993) erklärt er ausführlich seine Entwicklung vom Linken zum überzeugten Neoliberalen. Den Ausdruck Neoliberalismus bewertet Vargas Llosa allerdings als eine „von Feinden des Liberalismus kreierte Karikatur“. Er selbst sieht sich, so sein Biograf Juan José Armas Marcelo, als „liberal ohne weitere Zusätze, mit allem, was der Begriff traditionell bedeutet, politisch und intellektuell“. 1986 kritisierte er in Bezug auf Gabriel García Márquez die seiner Ansicht nach einseitige und kritiklose Überbewertung des sozialistischen Modells durch einige lateinamerikanische Intellektuelle: „Dass ein Schriftsteller in dieser Weise den Führer eines Regimes beweihräuchert, in dem es viele politische Gefangene – darunter mehrere Schriftsteller – gibt, das eine rigorose intellektuelle Zensur praktiziert, nicht die mindeste Kritik duldet und Dutzende Intellektuelle ins Exil gezwungen hat, ist etwas, das mich, wie wir im Spanischen sagen, mit fremder Scham erfüllt.“
Er ist nicht nur einer der meistgelesenen Schriftsteller Lateinamerikas, sondern seit längerem die führende intellektuelle Figur seines Kontinents. Er schreibt Kolumnen für „El País“, verkehrt auf zahlreichen akademischen Podien und hat einmal gesagt, er bewundere Margaret Thatcher. So einer entspricht nicht dem Image des Künstlers als Rebell, und auch das Ehrenzeichen eines „Querdenkers“ würde Vargas Llosa sich wohl kaum anheften. Nein, er ist für viele im Literatur- und Kulturbetrieb eine Figur, die ein wenig peinlich ist, nämlich den höflichen, rationalen, zu keinen Exzessen neigenden Rechthabenden. Er ist der unbarmherzige Realpolitiker seines Kontinents, der klarsichtige Analytiker und furchtlose Störenfried. Und er hat herausgefunden, dass sich der lateinamerikanische Kontinent mit der Utopie eines revolutionären Wegs (Castro oder Chávez, der Name spielt keine Rolle) selbst zugrunderichten würde; und dass jeder Schriftsteller, der diese Utopie mitträumt und in seinen Schriften verteidigt, sich mitschuldig macht.
Und er ist ein Autor, dessen literarische Werke Erkenntnismittel sind, um die Gegebenheiten und Mechanismen nicht nur lateinamerikanischer Politik und Gesellschaft zu analysieren und der außerdem über eigene oder fremde Werke mit einer Klarheit des Denkens schreibt, die ihn abermals verdächtig macht. Ein Genie habe gefälligst anders auszusehen.
Vargas Llosa sollte sich aber nicht nur in der Fiktion mit der Politik beschäftigen. 1989 bewarb er sich für das Präsidentenamt in Peru. Er versprach den Peruanern, den aufgeblähten Staatsapparat zurückzuschneiden, einen rigorosen Wirtschaftsliberalismus einzuführen, den kleinen Straßenhandel zu fördern und ausländisches Kapital ins Land zu holen. Schließlich unterlag er in einer Stichwahl Alberto Fujimori. Damit war seine politische Karriere beendet: „Unter mir hätte es keine zehnjährige Diktatur gegeben wie unter Fujimori, sondern eine Demokratie ohne Wenn und Aber. Wir hätten, hoffe ich, die Korruption effektiver bekämpft und die großen sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten verringert. Aber wer sich in der hypothetischen Welt bewegen will, der sollte lieber Romane schreiben: Die Fiktion gehört nicht in die Geschichte, sondern in die Literatur.“
Seitdem hat er sich wieder ganz dem Geschichtenerzählen gewidmet, wie er selbst im Vorwort der spanischen Ausgabe seiner gesammelten Werke schreibt. Doch weicht der erzählerische Furor der Anfangswerke Vargas Llosas in seinen späteren Werken einer eher klareren, ruhigeren Komposition.
Mit „La fiesta del chivo“ („Das Fest des Ziegenbocks“, 2000) schreibt er sich in die Tradition des lateinamerikanischen Diktatorenromans ein, indem er vom dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo, auch „Ziegenbock“ genannt, erzählt, der 1961 nach 31 Jahren autoritärer Herrschaft bei einem Attentat erschossen wurde. Der Roman ist in drei Handlungsstränge unterteilt, welche sich miteinander verflechten und das Regime Trujillos aus verschiedenen Perspektiven beleuchten: aus der Sicht des Opfers Urania Cabral, aus der Sicht des grausamen Diktators und aus der Sicht seiner Attentäter. Die Dominikanerin Urania Cabral hatte kurz vor der Ermordung Trujillos ihr Heimatland verlassen und war ins Exil in die USA geflohen. 35 Jahre später kehrt sie in die dominikanische Hauptstadt Santo Domingo zurück und besucht dort ihren Vater, der zum Kreis der engsten Vertrauten Trujillos gehört hatte. Ihre Erinnerungen führen zurück in die Jahre der gewalttätigen und korrupten Diktatur, in das Jahr 1961, als sich das Attentat auf Trujillo und die grausame Folterung der festgenommenen Verschwörer ereigneten. Die Schicksale der im Roman beschriebenen Personen bieten tiefe Einblicke in die physischen und psychologischen Bedingungen eines diktatorischen Regimes und ihre Folgen.
Mario Vargas Llosa führte fünfzig Jahre lang eine Ehe mit seiner Cousine, von der er drei Kinder bekam. 2015 dann gab er die Trennung bekannt: Mit 79 Jahren hatte er sich neu verliebt: „Liebe ist eine Erfahrung, die unser Leben auf den Kopf stellt. Alles verändert sich um uns herum. Und in dem gleichen Maße, in dem sie die Menschen glücklich macht, die sie erfahren, macht sie andere unglücklich. Aber ohne Liebe wäre das Leben doch unendlich grau und langweilig!“
Über die Liebe schrieb er denn auch 2006 mit „Travesuras de la niña mala“ („Das böse Mädchen“) einen hinreißenden Roman. Schon als aufmüpfige Halbwüchsige verdreht sie, die sich als Chilenin ausgibt, dem jungen Ricardo im konservativen Lima der 50er Jahre den Kopf. Doch als ihre Lüge auffliegt, taucht sie unter. Doch ihre Wege werden sich von da an regelmäßig kreuzen, mal als Guerrillera, mal als Heiratsschwindlerin mit falschem Paß in sein Leben treten – und es immer wieder durcheinanderwirbeln. Auf rätselhafte Weise scheinen beide dennoch füreinander bestimmt. Die Handlung spielt in Lima, kurz in Havanna, über weite Strecken in Paris, in London, Tokio und Madrid. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die wechselhafte Geschichte Perus, die der Erzähler nur aus der Ferne miterlebt, bilden den Hintergrund. Das Mädchen ist nicht einfach böse, sondern mit einem außergewöhnlich entwickelten Selbsterhaltungs- und Anpassungstrieb sowie mit einer besonderen Begabung für Schwindeleien ausgestattet, während der Ich-Erzähler des Romans, der gute Junge, in das bürgerliche Lager gehört. Dieser Gegensatz verhindert, dass die gegenseitige Liebe eine dauerhafte Erfüllung findet, immer nur kurz und heftig aufflackert und erst auf den letzten Seiten, in den letzten Lebenswochen des bösen Mädchens, uneingeschränkt bejaht wird.
Mit seinem folgenden Buch „El sueño del celta“ („Der Traum des Kelten“, 2010) erinnerte er an Roger Casement. Der irische Freiheitskämpfer hatte sich gegen die Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung im Kongo und im peruanischen Amazonasgebiet stark gemacht.
In der Todeszelle eines Londoner Gefängnisses im August 1916 in London hält er Rückschau auf sein abenteuerliches Leben. Er erinnert sich an die Jahre in Afrika, als er im Auftrag der britischen Regierung einen folgenreichen Bericht über die kolonialen Grausamkeiten im belgischen Kongo verfasste. Und er denkt weiter zurück an die Kindheit im irischen Ulster, seine zwiespältige Herkunft von einem streng protestantischen Vater und einer tiefgläubigen katholischen Mutter, die viel zu früh verstarb. An das Jahr 1906, als er ins peruanische Amazonasgebiet reist, um die grausamen Machenschaften eines Unternehmens zu dokumentieren, das mit britischem Kapital arbeitet. Was er dort sieht und hört, bringt ihn fast um den Verstand. Dabei wird ihm, dem Idealisten und öffentlichen Aufklärer, immer mehr seine eigentliche Mission bewusst. Heimlich begibt er sich nach Berlin und sucht deutsche Unterstützung für die irische Unabhängigkeitsbewegung. Doch in den Wirren des Ersten Weltkriegs gerät er zwischen alle Fronten und wird von seinen eigenen Landsleuten verraten.
Als Aufklärer und Held verehrt, als Verbrecher und Homosexueller verfemt, träumte er von einer freien, befriedeten Welt. Mario Vargas Llosa zeichnet schonungslos und eindrucksvoll dessen innere und äußere Kämpfe nach.
Sein bislang letzter Roman „Tiempos recios“ („Harte Jahre“, 2019) ist ein ebenso spannender wie faszinierender Roman über Guatemala als Spielball politischer Interessen im Kalten Krieg. 1954 stürzt die gemäßigte Regierung von Jacobo Árbenz durch den Militärputsch von Carlos Castillo Armas – ein Putsch, dessen Drahtzieher im CIA zu suchen sind und der auf einer geschickt lancierten Lüge basiert, die das Schicksal von ganz Lateinamerika bestimmen wird. Und die der amerikanische Präsident Eisenhower für sich zu nutzen weiß und die Schreckensvision, dass Guatemala unter sowjetischem Einfluss sei, Guatemala die Vorhut der kommunistischen Invasion in die USA markiere, propagiert. Mario Vargas Llosa erzählt diese Geschichte von internationalen Verschwörungen, gegenläufigen Interessen und den Jahren des Kalten Krieges in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit. Und er erzählt schließlich, wie die Henkersknechte am Ende zu Opfern ihrer eigenen Intrigen werden. Ein wahrhaft vielstimmiges Romanepos über Macht, Verschwörung und Verrat, über die Fallstricke der Geschichte und die dreisten Machenschaften imperialer Politik. Und Mario Vargas Llosa stellt damit ein weiteres Mal unter Beweis, dass seine literarischen Anordnungen ein nicht genug zu schätzendes Mittel der Politik- und Gesellschaftserkenntnis sind.
Foto: (c) Jerry Bauer






