Michael Köhlmeier - Der Märchenonkel
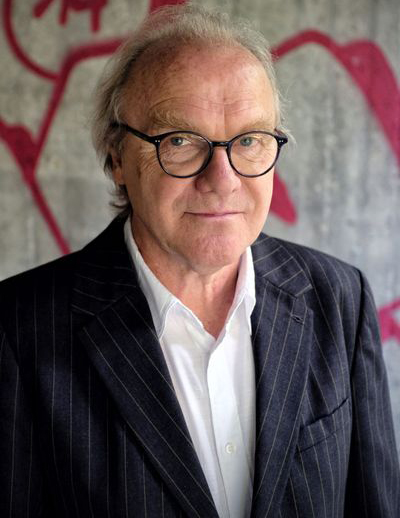
Veröffentlicht am 18.11.2019
Von Simon Berger
Vor über zwanzig Jahren, in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, begann Michael Köhlmeier, bislang bekannt gewesen für seine Romane und Erzählungen, sich für die alten Schriften von Hesiod und Ovid, den homerischen Epen und die Bibel zu interessieren. 1995 und 1997 erschienen von einem Projekt, das auf drei Bände angelegt war, die beiden Romane „Telemach“ und „Kalypso“ (der abschließende Band der Trilogie, „Penelope“, steht noch immer aus). Jedenfalls betreibt Köhlmeier darin eine Art aktualisierender Umschrift der homerischen „Odyssee“, die zuweilen bis hin zur Mythenparodie reicht. Danach erzählte er die in den homerischen Epen, den Schriften Ovids und Hesiods, im Alten und Neuen Testament sowie im Nibelungenlied enthaltenen Geschichten nach. Ausgangspunkte dafür waren zwei umfangreiche Hörfunkproduktionen des ORF, in denen Köhlmeier ab 1995 zunächst die „Sagen des klassischen Altertums“ in drei Staffeln und dann ab 1999 in zwei Staffeln die „Biblischen Geschichten“ weitgehend aus dem Stegreif paraphrasierte und in moderner Diktion mündlich wiedergegeben hat. Die Hörfunksendungen sind auf CD erhältlich, liegen aber auch – im Wortlaut geringfügig verändert – in gedruckter Form vor. Durch den betont umgangssprachlich gehaltenen Erzählduktus sucht Köhlmeier die ursprünglich mündlich vermittelten und erst im Laufe der Zeit verschriftlichten, schließlich zum Kulturmonument gewordenen Berichte aus der Starre der Kanonisierung zu befreien und sie neu in die Erlebniswelt der heutigen Zuhörer und Leser einzuspeisen.
Michael Köhlmeier schlüpft hier gewissermaßen in die Rolle eines modernen Gustav Schwab. Und hat damit überragenden Erfolg. Die meisten kennen ihn vor allem als Nacherzähler alter mythischen Geschichten und von Märchen.
Geboren wurde Michael Köhlmeier am 15. Oktober 1949 in Hard in Vorarlberg als zweites Kind des Historikers und Journalisten Alois „Wise“ Köhlmeier und dessen Frau Paula Köhlmeier, geb. Könner. Er besuchte die Volksschule in Hohenems und das Gymnasium in Feldkirch. Ab 1970 studierte er Politikwissenschaft und Germanistik in Marburg an der Lahn. 1976 schloss er das Studium mit dem ersten Staatsexamen und einer Arbeit über den Austrofaschismus ab und betrieb dann ein Zweitstudium der Mathematik und Philosophie in Gießen.
Anfang der 1970er Jahre wurde er mit Hörspielen im Österreichischen Rundfunk („Like Bob Dylan“, „Drei im Café spielen“, „Das Anhörungsverfahren“) und mit kürzeren Prosatexten als Schriftsteller bekannt (die erste Auszeichnung, den Rauriser Förderungspreis für Literatur bekam er 1974). 1972 gründete er zusammen mit dem Musiker Reinhold Bilgeri das Duo Bilgeri & Köhlmeier. Mit dem Lied „Oho Vorarlberg“ verzeichnete das Duo 1973 einen Erfolg in Österreich und waren sehr erfolgreich (pro Auftritt nahm jeder 30.000 Schilling ein). Seit 1980 lebt er als freischaffender Autor in Hohenems, wo er ein Jahr später auch die Autorin Monika Helfer heiratete.
Sein Gesamtwerk ist dementsprechend vielgestaltig. So schrieb er u.a. auch Songtexte, Libretti, Kinderbücher, Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Dabei gibt es zwischen den einzelnen Genres mehrfach Austauschbeziehungen: So hat Köhlmeier Dramen, einzelne Erzählungen und Teile von Romanen nachträglich zu Hörspielen umgearbeitet, aber auch umgekehrt aus Hörfunkproduktionen Theaterstücke oder Prosatexte gemacht. Das Zentrum seines Schaffens bilden jedoch seine zahlreichen Romane und Erzählungen. Dieses Prosawerk steht im Zeichen jener literarischen Entwicklung des späten 20. Jahrhunderts, die sich mit dem Schlagwort von der „Wiederkehr des Erzählens“ fassen lässt. Wie andere junge Autoren seiner Generation begann auch er sich, nach diversen Avantegardebestrebungen, wieder vertrauten Mustern der Erzählliteratur zuzuwenden.
Sein erster Roman, „Der Peverl Toni und seine abenteuerliche Reise durch meinen Kopf“ (1982), so der barock anmutende Titel, spielt wie später noch manche von Köhlmeiers Texten in dessen Heimat Vorarlberg. Anton Pevny (Spitzname: Peverl Toni) ist ein zarter, verträumter Junge, für den die Enge der Provinz und die Beschränktheit der Lebensperspektiven nur eine Ausflucht zulassen: die in die Imagination. An seinem siebzehnten Geburtstag (ein Schwellendatum zwischen Kindheit und Erwachsensein) taucht er in eine Fantasiewelt ein, in der die realen Naturgesetze nicht mehr gelten. In sieben Abenteuern lässt der Erzähler seinen Helden nach Art des Schelmenromans Unglaubliches erleben, bis die Handlung am Ende in eine surreale Zirkuswelt einmündet. Seinem Kopf entspringt nicht nur die Hauptfigur Anton Pevny, sondern er erfindet auch die Fantasiereisen seines Helden; das Erfundene und Erträumte generiert einen eigenen Kosmos des Fiktionalen, die Imagination wird als Motor literarischer Produktion vorgeführt.
Ähnlich skurril, aber zugleich realitätsnäher geht es in „Moderne Zeiten“ zu. Hauptfigur und Auslöser von allerlei Verwicklungen ist Kaspar Bierbommer, einer der nicht sterben kann und seit Jahrhunderten durch die Welt wandert auf der Suche nach seinem wahren Leben. Es ist eine originelle, witzige Groteske, ergreifend komisch. So verwandelt sich eine Frau in einen Kleiderschrank, ein Mann wird real zum Schwein und es passiert ein wahrlich tragischer Unfall bei der Österreichischen Bundesbahn. Vergnüglich wirbelt Köhlmeier hier Zeiten und Beziehungen, Wirklichkeit und Dichtung durcheinander.
Während die beiden ersten Romane noch auf Versatzstücke des Schelmen- und des französischen Romans zurückgreifen, etablierte er in der zweiten Hälfte der 80er Jahre einen eigenen Modus der psychologischen Recherche mit erzählerischen Mitteln, der die Voraussetzungen des Erzählens subtil mitreflektiert. Sowohl in „Die Figur“ (1986) als auch in „Spielplatz der Helden“ (1988) und „Die Musterschüler“ (1989) geht es um die erzählerische Rekonstruktion von Ereignisabläufen mit durchaus katastrophischen, auf jeden Fall immer unverhältnismäßigen Folgen.
In „Die Figur“ (1986) bildet die Ermordung des italienischen Königs Umberto I. durch den Seidenweber Gaetano Bresci das Ziel der literarischen Spurensuche. In „Spielplatz der Helden“ (1988) wird erkundet, weshalb drei Alpinisten auf einer Extremexpedition in Grönland zu erbitterten Feinden werden. Und in „Die Musterschüler“ (1989) lässt der Autor einen ehemaligen Mitbeteiligten an einem beinahe tödlich verlaufenen Bestrafungsritual in einem Knabeninternat nach den Ursachen für den kollektiven Gewaltausbruch fahnden. Jedes Mal erweist es sich aufs Neue, dass sich zwar Motivationsbruchstücke für das Tun der Personen aufspüren lassen, alle Erklärungsversuche aber letztlich fragwürdige Konstrukte bleiben, weil die nachträglich hergestellten Zusammenhänge die Irrationalität menschlichen Handelns nur überdecken. Erzählerisch stellen die beiden letztgenannten Romane eine Weiterentwicklung dar, weil hier (anders als in früheren Büchern) nicht mehr nur der Autor erzählt, sondern das Geschehen durch mehrere, teils widersprechende Ich-Berichte vermittelt wird, die außerdem durch das Dazwischentreten einer zusätzlichen, ebenfalls subjektiven Stimme bereichert bzw. gebrochen wird.
„Die Musterschüler“ ist eine beeindruckende psychologische Romanstudie in Form einer Parabel über die Entstehung gemeinschaftlicher Gewalt. Köhlmeier beschreibt darin ähnlich wie der Roman „Die Welle“ den vermeintlichen Gruppenzwang, die latente Bereitschaft zur Gewalt und das Thema Schuld, Vergessen, Verdrängung und Beschönigung bereits längst vergangener Geschehnisse im Jahr 1963. Diese bedrückende Schulgeschichte wird in Dialogform in einer Art Interview mit ständigen Zwischenfragen, zwischen zwei dem Leser unbekannt bleibenden Personen abgehandelt, wobei die befragte Person einer der vor 25 Jahren agierenden 14-Jährigen ist, der zur Aufarbeitung sämtliche damaligen Beteiligten, sofern er ihren Verbleib ermitteln konnte, aufgesucht hatte. Der Name des Erzählers wird übrigens nie erwähnt und bleibt unbekannt – im Gegensatz zu allen anderen Agierenden.
In den 90er Jahren verließ Michael Köhlmeier scheinbar das Modell erzählerischer Innovation. Sein Prosaschaffen fächerte sich sowohl inhaltlich als auch strukturell in eine Vielzahl parallel existierender Formen auf. Parabelhafte („Als das Schwein zu Tanze ging“, 1991; „Sunrise“, 1994) stehen neben autobiografisch grundierten Texten („Bleib über Nacht“, 1993; „Geh mit mir“, 2000), episodische („Bevor Max kam“, 1998; „Der traurige Blick in die Weite“, 1999) neben eher novellistisch zu nennenden Erzählkonstruktionen („Calling“, 1998; „Dein Zimmer für mich allein“, 1997).
„Trilogie der sexuellen Abhängigkeit“ (1997) beginnt in einem Café: zwei Männer sitzen links, zwei andere rechts, in der Mitte zwischen ihnen befindet sich eine Frau. Alle fünf Beteiligten sind Gefangene Ihrer selbst, Gefangene in ihrer Liebe, so der Erzähler. Diese Ausgangssituation wird plötzlich aufgelöst, aber es ist eigentlich nicht wichtig, was nach diesem „Zusammentreffen“ geschieht, sondern die Vorgeschichte, das „Vorher“. Die drei Vorgeschichten werden jeweils in „Theorie des Aufrisses“, „Theorie der völligen Hilflosigkeit“ und „Theorie des Heimzahlens“ geschildert. Allen dreien ist der Wunsch nach erfüllter Liebe gemeinsam. Im Mittelpunkt der Handlungsstränge steht immer eine Person, die verzweifelt auf der Suche nach erfüllter Liebe ist bzw. diese vergeblich versucht zurückzugewinnen. Michael Köhlmeier lässt dieses Gefühl der unerfüllten Liebe in drei verschiedenen Menschen, welche sich in unterschiedlichen Phasen der Liebe befinden, aufkommen und beschreibt humorvoll den Umgang mit dieser Situation. Die „Theorie des Aufrisses“ schildert das Verlangen nach Liebe, welche objektiv Verliebtheit genannt werden müsste. „Theorie der völligen Hilflosigkeit“ erzählt vom verzweifelten Versuch sich mit dem Schicksal des Verlassenwerdens abzufinden und wird als einzige der drei Erzählungen aus der Sicht einer Frau geschildert. Hingegen beschreibt „Theorie des Heimzahlens“ den Versuch nach der Trennung sich am Grund hierfür (dem neuen Geliebten) zu rächen.
In „Trilogie der sexuellen Abhängigkeit“ schildert Michael Köhlmeier die Liebe nach dem existenzialistischen Grundsatz „Liebe ist immer einseitig“. Die geschilderten „alltäglichen“ Situationen werden satirisch überspitzt gezeigt, auch wenn ein jeder Leser sich in einer der fünf Akteure wiederfinden kann. Am Schluss des Buches sitzen alle in diesem kleinen Café und Nietzsches „Wiederkehr des ewig Gleichen“ führt uns zurück zum Anfang des Buches, einem kurzweiligen Büchlein, dass sich sprühend von originellem Humor mit der Liebe als Abhängigkeit und Sucht beschäftigt.
In „Geh mit mir“ (2000) begegnet der Leser in einem Moment, wo sich das Leben für immer von der Vergangenheit löst, dem sensiblen und merkwürdig vertrauten Helden Alois Fink, genannt Wise. Wise ist zurück in seiner Heimat, zurück am Bodensee bei den Eltern, die noch immer in dem kleinen Wochenendhäuschen wohnen, das seine Mutter seit ihrem schrecklichen Unglück nur selten verlassen hat. Von dort brechen Mutter und Sohn schließlich noch einmal auf zu einer ungewöhnlichen Reise.
Diese Familiengeschichte bietet nichts Außergewöhnliches und fesselt den Leser dennoch durch die Ereignislosigkeit, das Alltägliche einer Familie, die sich von der Normalität abzugrenzen trachtet und sich gleichzeitig in einer eigens konstruierten Gleichförmigkeit stabilisiert. Teils nüchtern, teils naiv, fast durchgängig teilnahmslos wird diese Familie in einer "braven Sprache" porträtiert, der Vater, ein "Schnarchspießer im 68er-Gewand", die Schwester Johanna, die Mutter und Wises Freundin Franka, die allesamt in einem kleinen Städtchen am Bodensee leben. Michael Köhlmeier erzählt hier (über Wise Fink) seine eigene Familiengeschichte, deren verborgene Wahrheit er nach und nach zu begreifen beginnt.
Die sicherlich wichtigste Sparte bildet jedoch die erzählerische Neukonstellation antiker und mittelalterlicher Stoffe. So ist ein erstes Projekt auf insgesamt drei Bände angelegt, von dem „Telemach“ (1995) und „Kalypso“ (1997) erschienen sind – der abschließende Band der Trilogie („Penelope“) noch immer aussteht. Hier betreibt Köhlmeier eine aktualisierende Umschrift der homerischen „Odyssee“, die zuweilen bis hin zur Mythenparodie geht.
Von der Literaturkritik wurden die beiden Romane teils hoch gelobt, ihre „vitale Originalität“ hervorgehoben, der „Reiz des Ungewohnten“ , doch wurde Köhlmeier auch zum „aufgeblasenen Schwätzer“ ernannt, die Liebesgeschichte zwischen Kalypso und Odysseus auch als „sprachliches und inhaltliches Fiasko“ klassifiziert.
In einem zweiten Projekt erzählt Michael Köhlmeier die in den homerischen Epen, den Schriften Ovids und Hesiods, im Alten und Neuen Testament im Nibelungenlied sowie in den Stücken William Shakespeares enthaltenen Geschichten nach.
Schließlich schlüpfte Michael Köhlmeier an der Wende des 20. zum 21. Jahrhundert gewissermaßen in die Rolle eines modernen Gustav Schwab, der die Tradierung vom Vergessen bedrohten kulturellen Bildungsguts zu seiner zentralen Aufgabe macht. Weil der die mythischen Erzählungen aber in erster Linie als Geschichtenreservoir begreift, zielt er – im Gegensatz zu Gustav Schwab – nicht auf eine monumentalisierende Darstellungsweise ab. Auch geht es ihm nicht um die historische Rekonstruktion des Mythos, ja der Leser erfährt sowohl in den Romanen als auch in den Nacherzählungen kaum etwas über die konkreten Lebensbedingungen der Menschen in der antiken Welt. Stattdessen werden die handelnden Figuren radikal vergegenwärtigt und handeln lediglich vor mehr oder weniger bekannten Kulissen. Die Kritiker haben aus diesem Grund zu Recht von „Attrappen des klassischen Altertums“ (so etwa Franz Haas) geschrieben. Um seinen Hörern und Lesern das längst Vergangene nahe zu bringen, setzt Köhlmeier auf eine radikale, oft gewollt banalisierende Aktualisierung der Vorlage.
Indem er das Geschehen psychologisiert (an dieser Stelle taucht unvermutet das Interesse an erzählerischer Innovation wieder auf), ebnet er dem Unterschied zwischen den überlebensgroß wirkenden Figuren des Mythos und dem Erlebnishorizont der Jetztzeit konsequent ein: Sisyphos etwa wird kurzerhand zum „Zwangsneurotiker“ („Sagen des klassischen Altertums“, 1996) erklärt. Eine solche Transposition der Stoffe ins Heute arbeitet zwar den Kern menschlichen Agierens heraus, reduziert die Motive des Tuns aber auch auf das immer Gleiche. Dient die psychologische Mythendeutung wesentlich dazu, die antiken Figuren zu vermenschlichen, wendet Köhlmeier in seinen in der Gegenwart angesiedelten Romanen und Erzählungen vielfach die umgekehrte Verfahrensweise an. Während er die mythischen Stoffe der Weltliteratur entheroisiert, unterlegt er im Gegenzug seinen selbst er- bzw. selbst gefundenen Geschichten gern einen mythischen Bedeutungshintergrund und hebt sie dadurch über das bloß Individuelle hinaus.
So verweisen beispielsweise Titel und Motto von „Bleib über Nacht“ (1993) auf das biblische Buch Ruth und zitieren so das wohl prominenteste Beispiel eines aufgeschobenen Liebesaktes. Überhaupt zeichnen sich Köhlmeiers Texte durch eine ausgeprägte Intertextualität aus, die in ihrer teilweise wilden Kombination spielerisch-postmodern wirkt. Dem entspricht auch der Umstand, dass er in seinen Nacherzählungen keinerlei Unterschied zwischen antiken, nordischen und christlichen Mythen macht. Der Mythos gilt ihm, unabhängig von seiner Herkunft und seinem Entstehungskontext, als eine Art von Ur-Erzählung, als ein grundlegendes Erzählmuster zur Wiedergabe archetypischer Grunderfahrungen, gleichgültig, ob sich diese in Extremsituationen oder in unscheinbaren Alltagsmomenten abspielen.
Der Schriftsteller Sebastian Lukasser soll in „Abendland“ (2007) die Lebensbeichte von Carl Jacob Candoris niederschreiben. Candoris ist Mathematiker, Weltbürger, Dandy und Jazz-Fan und 95 Jahre alt. Sebastian Lukasser ist der Sohn des Gitarristen Georg Lukasser, den Candoris in den Jazz-Kellern im Wien der Nachkriegsjahre kennengelernt hat. Candoris erzählt von seinem Großvater, der in Wien einen berühmten Kolonialwarenladen betrieb; von seinen seltsamen Verwandten, bei denen er in Göttingen während seines Studiums lebt und die Größen der Naturwissenschaft kennenlernt; und vom Wien der Nachkriegszeit, wo Sebastians Geschichte beginnt, die Geschichte einer Selbstfindung, die sich über die zweite Hälfte des Jahrhunderts zieht.
Michael Köhlmeier hat mit "Abendland" einen „Jahrhundertroman“ geschrieben, auf jeden Fall einen Generationsroman des 20. Jahrhunderts, dem es mitunter gelingt, der Sogwirkung, die die Nazizeit ausübe, zu entgehen. Liebevoll wird der hochbetagte Candoris beschrieben, der quasi alle Ereignisse und Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts miterlebt hat. Doch wichtiger waren ihm seine persönlichen Begegnungen mit Figuren wie Emmy Noether, Django Reinhardt und Billie Holiday. Köhlmeier trifft damit sicherlich die Geschichtserfahrung der jüngeren Generation, für die die Katastrophengeschichte des vergangenen Jahrhunderts eine Erzählung unter anderen ist. Und er vergisst in dieser großen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts nicht die Totalitarismuserfahrungen, wiewohl er die persönlichen Erfahrungen in den Vordergrund stellt.
In der wahrlich verstörend schönen Novelle „Idylle mit ertrinkendem Hund“ (2008) spazieren zwei Männer am Rhein-Ufer entlang, ins Gespräch vertieft. Es ist tiefer Winter, die Seitenarme des Flusses sind zugefroren, doch der Föhn spielt Frühling, es taut. Von weitem sehen die beiden einen großen schwarzen Hund über das Eis auf sie zulaufen. Plötzlich bricht er ins Eis ein. Der Hund kämpft um sein Leben. Einer der Männer, der Lektor, holt Hilfe. Der andere, er ist Schriftsteller, bleibt alleine mit dem Hund. Er bricht einen großen Ast von einer Weide und kriecht auf diesem zu dem Hund. Er fasst ihn an den Vorderläufen. Der Hund verbeißt sich in seinem Ärmel. Er wird den Hund nicht retten können. Doch der Tod hat vor einigen Jahren eine so tiefe Wunde in sein Herz geschlagen, dass er ihm unter keinen Umständen dieses Leben überlassen will. Er hält den Hund verzweifelt fest, auch als der sich schon längst nicht mehr rührt.
Das eigentliche Thema der Novelle ist Tod der Tochter des Autors, Paula, die 2003 beim Bergwandern im Alter von 21 Jahren tödlich verunglückte. Die Art, wie Michael Köhlmeier sich in diesem Buch damit auseinandersetzt, macht diese Novelle zu etwas Außergewöhnlichem: denn vollkommen unverstellt lässt Köhlmeier hier den Leser an der Trauer teilhaben, ohne dass der sich je wie ein Eindringling fühlt.
In „Madalyn“ (2010) beschreibt Michael Köhlmeier die erste Liebe einer 14-Jährigen in ihrer "ganzen lodernden Farbenvielfalt" (so eine Literaturkritikerin). Es ist eine klassische Geschichte. Madalyn ist ein einsames Kind. Der einzige, dem sie sich anvertraut, ist ein älterer zurückgezogener Schriftsteller, Sebastian Lukasser, den der Leser schon aus Köhlmeiers Roman "Abendland" kennt. Dieser Lukasser möchte in die Geschichte eigentlich gar nicht hineingezogen werden. Aber er kann sich nicht entziehen, muss "Tröster und Lebensretter" sein. Der Leser nimmt die Liebelei zwischen den Jugendlichen Madalyn und Moritz aus der Sicht des väterlichen Freundes Madalyns, dem Schriftsteller Sebastian Lukasser, wahr. In Gesprächen zwischen den beiden berichtet das Mädchen, wie Moritz sie mit kleinen Lügen und Täuschungen immer wieder hinhält, damit aber auch fasziniert und an sich bindet. Köhlmeier veranstaltet ein virtuoses Spiel mit der Täuschung, denn in den Darstellungen des Spiels der beiden Teenager zeichnet er auch sein eigenes Dasein als Täuscher und Geschichtenerzähler nur allzu bewusst und baut damit geschickt eine Beleuchtung des eigenen Schriftstellertums in den Roman mit ein.
Der Held und Erzähler des nächsten großen Romans von Michael Köhlmeier („Die Abenteuer des Joel Spazierer“, 2013) ist der unter dem (falschen) Namen Joel Spazierer im Budapest der Nachkriegszeit. Er ist in Wien auf die schiefe Bahn geraten, seine kriminelle Karriere hat ihn mitunter durchs kommunistische Ungarn, durch Österreich, die Schweiz, Westdeutschland und Mexiko getrieben – und in der DDR hat er es sogar zum Professor für Philosophie gebracht. In Wien trifft er, nun über sechzig Jahre alt, seinen Freund Sebastian Lukasser wieder, der ihn ermuntert, seine unglaubliche Lebensreise aufzuzeichnen. Von sich selbst sagt er: "Ich besaß nie den Ehrgeiz, ein guter Mensch zu werden; auch wenn ich eine Zeitlang glaubte, Moral gehöre zu unserer Grundausstattung." Der umfangreiche Roman in Episoden zeigt wiederum Köhlmeiers Einfallsreichtum, der den Leser durch die halbe europäische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führt.
Nach seinen beiden großen Romanen ist auch das nächste Buch von Michael Köhlmeier thematisch im 20. Jahrhundert angesiedelt. "Zwei Herren am Strand" (2014) erzählt die eigenwillige Freundschaft von Charlie Chaplin und Winston Churchill, zwei der bedeutendsten Persönlichkeiten dieser Epoche, vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Zweiten Weltkriegs. In einer Frühlingsnacht des Jahres 1927 stehlen sich zwei Herren unbemerkt von einer Strandhausparty in Santa Monica davon, treffen draußen zufällig aufeinander und beschließen, am Strand spazieren zu gehen. Trotz ihrer ungleichen Herkunft, Ideologie und Lebensanschauung entdecken sie eine verhängnisvolle Gemeinsamkeit: Beide werden regelmäßig von schweren Depressionen und Suizidgedanken heimgesucht. Sie schließen einen Pakt gegen diesen "schwarzen Hund", wie Churchill die Krankheit nennt. Wann immer einer der beiden die Dringlichkeit verspüre, seinem Leben ein Ende zu setzen, würde der andere bedingungslos zur Stelle sein. Geschildert werden die Zusammentreffen aus der Perspektive eines Ich-Erzählers, der als Puppenspieler in einer deutschen Kleinstadt lebt. Sein Vater sei als Kind zufällig den beiden historischen Persönlichkeiten begegnet und später in Briefkontakt mit Churchills engstem Vertrauten gestanden. Er, der Erzähler, gibt sich nun als ambitionierter Chronist der ungleichen Freundschaft, die er anhand der Korrespondenzen des Vaters und anderer angeblich vertraulicher Quellen nachzeichnet. Der Roman ist, wie schon Köhlmeiers letzte Bücher, ein charmantes literarisches Spiel mit Wahrheit und Schwindel, dessen Erzählfluss man sich gerne hingibt.
In der Erzählung „Das Mädchen mit dem Fingerhut“ (2016) kommt in einer westeuropäischen Stadt ein kleines Mädchen einen Markt. Sie hat Hunger, versteht kein Wort der Sprache, die man hier spricht. Doch wenn jemand „Polizei“ sagt, fängt sie an zu schreien. Sie weiß selbst nicht, woher sie kommt, wie sie heißt. Yiza, sagt sie, also heißt sie von nun an Yiza. Als Yiza zwei Jungen trifft, die genauso alleine sind wie sie, tut sie sich mit ihnen zusammen. Sie kommen ins Heim und fliehen; sie brechen ein in ein leeres Haus, aber sie werden entdeckt. Köhlmeiers Märchenparabel über Wolfskinder erzählt von einem Leben am Rande und von der kindlichen Kraft des Überlebens und vom Mitleid.
Auch den Geschwistern Robert und Jetti Lenobel, den Protagonisten von „Bruder und Schwester Lenobel“ (2018), konnte man schon das eine oder andere Mal in Köhlmeiers Büchern begegnen. Nun stehen die beiden im Mittelpunkt eines großen Romans, der Geschichte einer Familie, die wie nebenbei wiederum ein Zeitporträt entwirft.
Die Geschwister Lenobel sind von klein auf zusammengeschweißt zum einen durch ihre Kindheitsgeschichte (der Vater hat die Familie verlassen, die Mutter ist an Schwermut erkrankt), zum anderen durch das Trauma der NS-Vergangenheit. Robert und Jetti sind die Enkel ermordeter Juden. Es geht um Familiendynamik und Beziehungschaos, Fluchten und Ausfluchten, Lebenskrisen und Identitätssuche. Und auch Sebastian Lukasser, der sich als Alter Ego von Köhlmeier schon mehrfach bewährt hat, ist hier mit dabei.
Bei vielen gemeinsamen Auftritten und mittlerweile in zwei Büchern will Michael Köhlmeier mit dem Philosophen Konrad Paul Liessmann im Dialog die „dunkelsten Seiten der menschlichen Existenz“ erkunden. In „Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?“ (2016) und „Der werfe den ersten Stein“ (2019) dreht sich alles um menschliche Grundsatzfragen, um verführerische Verdammungen und die schlimmsten Formen menschlicher Bosheit: um Wahrheit, Schuld, Unterwerfung, Verrat, Betrug, Intrige. Wer ihr zum Opfer gefallen ist, dem bleibt als Befreiungsschlag oft nur die Verdammung des Gegners. Die Weltliteratur kennt viele Verdammungen, in der Bibel, auf der Bühne, in Märchen und Legenden. Michael Köhlmeier erzählt ein gutes Dutzend Beispiele aus dem Mythenschatz, die Konrad Paul Liessmann philosophisch kommentiert.
Zuletzt erschien nun eine wundervolle Ausgabe von „Märchen“ von Michael Köhlmeier. Über 800 Seiten umfasst sein von Nikolaus Heidelbach illustriertes Märchenbuch. Die Märchen hier sind keine Nacherzählungen bekannter Stoffe, sondern eigene Erfindungen, verstörende, unheimliche Geschichten.
Für Köhlmeier sind Märchen „eine ewige Umformung von ewig Gleichem“, nur sehr wenige hätten in der Literaturgeschichte neue Märchen erfunden. Das Besondere eines Märchen liegt für ihn „im Wie und nicht so sehr im Was“. So wie Literatur überhaupt für ihn in der „Umgestaltung, Neugestaltung, Interpretation von überlieferten Stoffen, Aneignung von Überbrachten“ besteht. „Wer sich nie in die große Tradition von Erzählt-Bekommen und Weitererzählen begeben, nie den Stab übernommen und weitergereicht hat, der soll sich nicht Erzähler nennen, der ist ein Pointenschreiber“, meinte er einmal in einem Interview.
Dass er auch ein eminent politisch denkender Mensch ist, davon konnte man sich in seiner nur wenige Minuten dauernden Rede am 4. Mai 2018, dem österreichischen Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus, in der Wiener Hofburg überzeugen. Seine Konklusion „Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle“ wurde zum eingängigen Titel der Rede, die mit anderen dann auch in einem Buch erschien. Eindringlich und klar wandte er sich gegen all die Politiker der FPÖ, die fast im Wochenrhythmus antisemitische und rassistische Äußerungen von sich geben. Die Rede ist ein beeindruckender Kommentar zur Politik unserer Tage, in der Verleumdung und Niedertracht üblich geworden sind. Und ein wortmächtiger Appell, sich gegen die Verheerungen des Faschismus zu empören und den schleichenden Verfall unserer politischen Kultur aufzuhalten.
Foto: © Peter-Andreas Hassiepen






