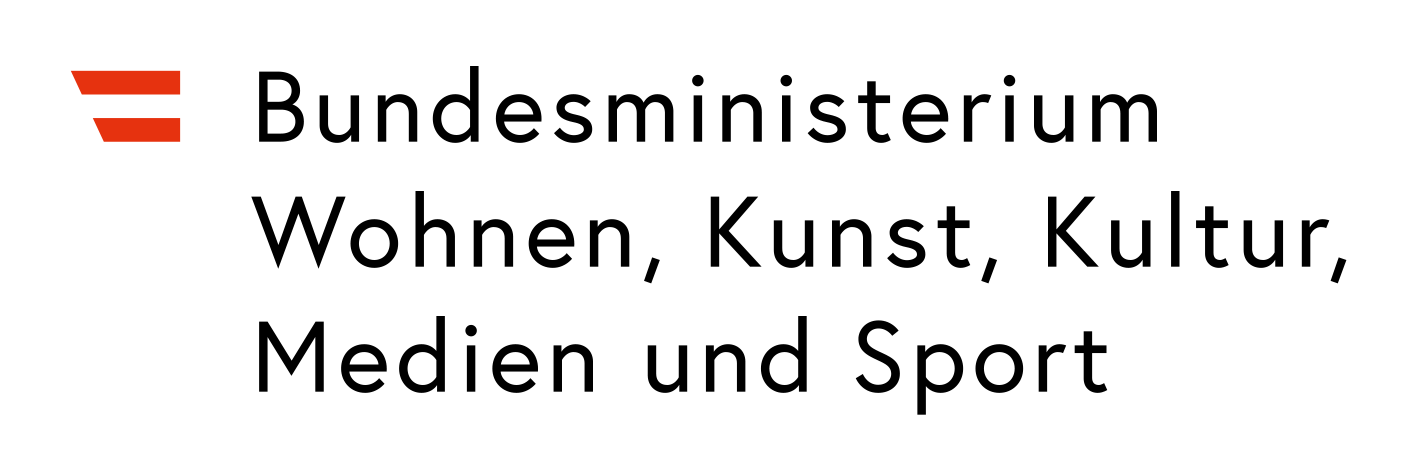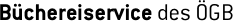Ralf Rothmann - Zwischen dem Einzelnen und dem Absoluten

Veröffentlicht am 22.06.2023
Simon Berger über Ralf Rothmann, zum 70. Geburtstag.
Bekannt wurde er mit seiner Ruhrpott-Romantrilogie („Stier“, „Wäldernacht“, „Milch und Kohle“), die, die ihn zum Schulbuchautor gemacht und die er 2004 mit „Junges Licht“ noch zur Tetralogie erweitert hat. Die Höhe seiner Meisterschaft erreichte er dann mit seiner zweiten Trilogie, seiner zu recht gefeierten Kriegs- und Nachkriegs-Trilogie, dessen letzter Band „Die Nacht unterm Schnee“ seine grandiose Vergegenwärtigungskunst durch realistisches Erzählen abrundet.
Er nennt sich selbst einen „altertümlichen Schriftsteller“, und er ist einer im eindringlichen Sinn: Mehr als suspekt ist ihm, wie er in einem Gespräch meinte, nämlich dieser neue Autorentypus, der „nur noch von Event zu Event hopst, immer nur Präsenz zeigt, in Talkshows herumhängt“. Denn, so ist Rothmann überzeugt: „Ich glaube, dass die innerste Wahrheit ihres Tuns damit beschädigt wird. Poesie bleibt eine Sache zwischen einem Einzelnen und dem Absoluten, so pathetisch das klingt. Sie stellen keinen Text her, der ans Herz geht oder das Herz hebt, wenn Sie permanent auf irgendwelchen Empfängen herumstehen.“
So redet naturgemäß nur jemand, der in seinem Schreiben sein Heil gesucht und gefunden hat. Man nimmt ihm dieses Pathos ab, weil ohne die Literatur würde er jetzt vielleicht auf einer Baustelle als Polier arbeiten und etwa den Putz der Häuser ausbessern.
Als „nicht gerade typisch“ bezeichnet der am 10. Mai 1953 in Schleswig als Sohn eines Bergarbeiters geborene und im Ruhrgebiet aufgewachsene Ralf Rothmann seine Sozialisation: Auf die Volksschule und einige Monate Handelsschule folgen eine Maurerlehre, dann Anstellungen als Krankenpfleger, Taxifahrer, Koch. Eine traumatisierende Zeit, wie er einmal erzählt: „Mein ganzes Umfeld war geprägt von Gewalt, aber auch von ständiger Geldnot, und das hat per se schon, auch in der Familie, eine aggressive Grundstimmung mit sich gebracht. In diesem Umfeld und dann möglicherweise auch als ein etwas sensibleres Kind heranzuwachsen und noch dazu Interesse an Büchern zu haben, da hatte man schon das Gefühl, ein Außenseiter zu sein. Und auf denen wird traditionell herumgeprügelt. Das Schreiben war dann sicher auch so eine Art psychohygienischer Akt.“
„Zu jung für die 68er, aber zu alt für den Punk” (wie er einmal meinte), begann er, inspiriert von der Musik der 60er Jahre, den „Hymnen zum Aufbruch“, eigene Songtexte zu schreiben. „Die Rock- und Pop-Musik war damals für mich schon so etwas wie eine ästhetische Schule. Mein heutiges rhythmisches Empfinden als Schriftsteller, mein Empfinden für die klangliche Logik der Sprache, das habe ich alles aus der Zeit. Mit 16 fing ich an, erste Gedichte zu schreiben, und als ich dann nach Berlin kam, da habe ich gedacht, jetzt mache ich ernst damit.“
KRATZER
In Berlin fand er in den Lyrikern Christoph Meckel und Jürgen Theobaldy so etwas wie Lehrer- und Leitfiguren. Sein Debütband „Kratzer“ (1984), der in einem kleinen Berliner Verlag erscheint, wird gut besprochen und über Vermittlung von Christoph Meckel wird der Suhrkamp Verlag auf ihn aufmerksam, dem er bis heute die Treue hält.
In etlichen „Kratzer“-Gedichten stellte er seine verzagend-hoffnungslosen Lebensanwärter vor. Schuften, ohne die Sonne zu sehen, und unter dem Titel „Geburtstag” die Zeilen: „Jeden Tag bricht eine Welt zusammen, und ich liege im Sterben von Anfang an.” Dazu „Bergschäden, Familienbild”, und die Grundkonstellation aus erniedrigender, zerstörerischer Arbeit und unerreichbarer Privatidylle: „Unter Tage schaufelt uns ein Mann / ein schön möbliertes Grab / und Töpfe voller Eintopf. / Im Dunkeln verblüht sein blauer Blick / und Flüche schwärzen seinen Stern.”
Die prosanahen Gedichte lassen sich als Ausdruck einer zerrissenen Existenz lesen, zwischen Lebensangst, Trotz und ungebrochenen Träumen, „zu Tode betrübt / und vor Lebenslust jammernd“. Es sind, so Thomas Kraft, „Bilder voller (Selbst-)Ironie, in denen sich Zuversicht, Leiden und Zorn zugleich spiegeln, dazu ein verführerischer Spritzer Neugier, um dann doch zu schmerzhaften Erfahrungen zurückzuleiten“. Eine „kratzige, heftige Realistik, gut gebaute Verse, genaue Sätze“ (Christoph Meckel), „kühn geträumt, mit wuchtigen Bildern“ (Ludwig Fels).
Paradoxa, unvermittelte Kehrtwendungen und ironische Brüche zeichnen auch die Gedichte seines zweiten Bandes „Gebete in Ruinen“ (2000) aus. Es ist tatsächlich voll kratzbürstiger und hakender Bilder und Gedanken, oft hart gereimt und mit der Form des Gebetes mitunter frech spielend.
Doch trotz aller Wunden aus dem Kampf um ein bisschen Glanz im Leben bleibt die Hoffnung auf Erlösung der Impuls aller Anstrengung. So berichten Rothmanns Texte auch stets von einem großen Aufgehobensein. „Wenn du dich für die Freiheit entschieden hast, kann dir gar nichts passieren. Nie.” Das Zitat aus dem Roman „Junges Licht“ bündelt diese tröstliche Haltung aufs Schönste.
Seine erste Erzählung, „Messers Schneide“ (1986), ist eine Liebesgeschichte, die nicht gut ausgeht. Es ist eine Geschichte über die Fühllosigkeit und den Ekel „vor der trotzigen Bekundung, nichts mehr zu fühlen“, über den Bann des Weiblichen und der Sexualität, ihrer Nähe zur Gewalt. Und es ist auch eine poetische Geschichte, in der eine (der Liebe entsprechende) fast pathetische Sprache in vielen Bildern anklingt, die vom Autor immer wieder auf nüchternen Boden zurückgeführt wird, hinein in eine Art Radikalität des Lebens.
In „Der Windfisch“ (1988) ist Guntram Lohser, Mitte 30, der seit zehn Jahren als Photograph arbeitet, von der Nutzlosigkeit seiner Arbeit frustriert. Um nicht in den Berliner Winter zurückkehren zu müssen, hängt er nach einem dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in Mexiko, an dessen Ende ihm seine Ausrüstung gestohlen wurde, noch ein paar Wochen Urlaub in Ecuador dran. Er lässt sich von momentanen Eingebungen und Launen treiben und landet kurz vor der Regenzeit in Muisne, einem Kaff am Meer. Dort trifft er auf merkwürdige Gestalten: einen Alten, der nur noch mit und für seine Ziegen lebt und auch so riecht, eine mysteriöse Französin, die auf der Suche nach etwas zu sein scheint, einen eifersüchtigen Sohn und lüsterne einheimische Frauen. Was wie die Sinnsuche eines übersättigten Mitteleuropäers beginnt und dann in eine Art Abenteuerroman abzugleiten scheint, ist eine auch mit Krimielementen versehene konsequente Erzählung eines Mannes auf der Suche nach Sinn in seinem Leben.
Rothmann ist kein resignierter Vertreter einer Welt im Niedergang, vielmehr ein äußerst warmherziger, Anteil nehmender Erzähler mit großem Sinn für Humor. Er erzählt unterhaltsam vom tristen Leben der „grauen Masse”. Trotz durchaus vulgärer Szenen schafft er es stets, die nötige Distanz zu wahren. Als Leser fühlt man sich geführt von einem, der die geschilderten Milieus der „kleinen Leute” kennt, diese durchleuchtet, ohne sie zu verraten. „Ich hatte nie ein Programm, und meine Absicht war stets, andere mit meiner Arbeit glücklich zu machen. Daran hat sich nichts geändert”, erklärte er noch jüngst in einem Interview.
RUHRPOTT-TETRALOGIE
Seine berühmte Ruhrpott-Trilogie („Stier“, 1991, „Wäldernacht“, 1994, „Milch und Kohle“,2000; 2004 mit „Junges Licht“ noch zur Tetralogie erweitert) sind elegische Adoleszenzromane. Sie weinen der verlorenen Kindheit und Jugend ein paar Tränen hinterher und zugleich zittern sie vor Empörung und Empathie mit seinen jugendlichen Helden, die sich in diesem autoritären, gewalttätigen, desolaten Ruhrpott-Soziotop der 50er und 60er Jahre behaupten müssen. „Hunger, Durst und Geilheit“, sagt der Ich-Erzähler in „Stier“, „das war die Skala der Gefühle, Zwischentöne gehörten in die Hitparade“. Nur unter großen Mühen und Schmerzen können sie sich emanzipieren, meistens mit Hilfe der Kunst. Wie eben der Autor selbst. Ralf Rothmann räumt das autobiografische Substrat dieser Bücher freimütig ein: „Ich kann nur über die Dinge schreiben, die ich erfahren habe. Ich kann nichts erfinden, oder wenn, dann immer ganz nah dran am wirklich Erlebten. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass meine Sprache mich selbst nicht befriedigt, wenn ich was erfinde, dass ihr eine gewisse Schwerkraft fehlt.“
Mit diesen Romanen hat er sich als „Chronist des Ruhrpotts” mehr als nur die eigene Herkunft bewahrt und sich seit den frühen 90er Jahren als Autor durchgesetzt. Die Ruhrpott-Romane rekonstruieren überzeugend die Enge kleinbürgerlicher Familien im Deutschland der 60er und 70er Jahre. Späte Nachkriegsdumpfheit reibt sich am Aufkommen einer neuen Zeit, doch die rohe Kraft aufmüpfiger Halbstarker kommt selten über Essen oder Duisburg hinaus.
Leser in Ralf Rothmanns Alter mögen erkennen, welche Umwege auch sie beim Trainieren von Stolz und Würde zurückgelegt haben. Jüngere lernen mit den Büchern „dieses aussöhnenden Beobachters, dessen punktgenaue Schnoddrigkeit kaum Sentimentalität zulässt“ (so Michael Borrasch), wie öde muffig früher pubertiert wurde. Indem Ralf Rothmann im Inneren des grauen Alltags seiner so verbissen arbeitenden Helden stochert, kann er ihnen mit feiner Sprache Würde zurückgeben. Gerade seine distanzierte Haltung jenseits aller Folklore sorgt dabei für Glaubwürdigkeit.
„Ich weiß nicht, was ‚Literatur der Arbeitswelt’ ist“, so Ralf Rothmann: „Ich kenne nur Literatur. Und die verdient ihren Namen nur, wenn sie unseren Sinn für die Leiden anderer wach hält, wenn sie uns zum Mitleiden bewegt.”
Neben dem Bewahren einer „abgewickelten“ Welt stehen im Zentrum seiner Romane sensibel beobachtete pubertierende Jugendliche: „Man kann alles mögliche mit Liebe entschuldigen. Doch wer seine Jugend verrät, sagte er, wer sie als Spielerei oder grün abtut, der ist bereits verdorrt. Denn sie hat recht, nur sie!”, heißt es in „Stier“. Dass seine Hauptfiguren häufig schüchterne Jünglinge sind, die oft die tollsten Mädchen abbekommen, ohne dass ihnen die Versprechungen der Liebe ganz geheuer wären, fällt auf. Wer von Kindertagen an die auseinander driftende Ehe der Eltern vor Augen hat, wie etwa der 15-jährige Simon in „Milch und Kohle“, musste solche Skepsis wohl entwickeln.
Es geht bei diesem „poetischen Realisten” immer wieder um die großen, ewigen Themen: Kindheit und Jugend, Einsamkeit und Gemeinschaft, Aufbegehren und Abschiednehmen, Alter und Tod, das Suchen nach einem Platz in all den Jahren, im Gegenüber. „Arbeit und Freiheit, Gewalt und Liebe, Frust und Sehnsucht, kalter Sex und flimmernde Zärtlichkeit – Rothmanns Prosa packt durch ihre realitätsraue Sättigung, sucht aber gleichzeitig Dimensionen, die über das Profan-Alltägliche hinausweisen. Die besondere Kunst dabei: dank eines sorgfältig gearbeiteten Stils entstehen Leseerlebnisse von robuster Eleganz“ (Michael Borrasch).
JUNGES LICHT
Mit „Hitze“ (2003) erzählt Ralf Rothmann einen Großstadtroman aus unseren Tagen, in dem er nicht nur die unterschiedlichsten sozialen Existenzen und Milieus zu beschreiben versteht – und gleichzeitig eine wunderbar melancholische Liebesgeschichte. Den Hilfskoch Simon DeLoo, der Essen ausführt, hat der Tod seiner Lebensgefährtin aus allen Zusammenhängen gerissen. Auf seinen Touren trifft er Lucilla, eine junge Stadtstreicherin aus Polen, in der er seine frühere Frau wiederzusehen glaubt. Er versorgt sie mit deren Kleidung, überlässt ihr die leerstehende Wohnung, doch sie entzieht sich ihm, und erst in ihrer Heimat, in der vor Hitze flirrenden Landschaft der Pommerschen Seenplatte, sieht er sie wirklich: ihr Gesicht, in dem es „etwas Helleres gibt als Intelligenz“, ihren Körper, der ihn verwirrt: „Plötzlich empfand er deutlich, was das ganze Leben in ihm vorbereitet hatte, so wie ein ferner Ton, seine Schwingung, die Moleküle stimmt, bis sie Jahrhunderte später eine Form annehmen, den Hauch einer Maserung im Kork, eine grüne Spitze zwischen Steinen.“ Doch am Ende des Romans landet DeLoo wieder im winterlichen Berlin, ohne Hoffnung, aber auch ohne Verzweiflung: frei.
„Junges Licht“ (2004) erzählt von den Sommerferien des zwölfjährigen Bergarbeitersohns Julian und in einer zweiten Erzählebene von der Arbeit seines Vaters unter Tage. Die Welt der Bergleute und ihrer Kinder um 1960 erscheint dabei vor allem aus der Perspektive des Jungen. Ein Zwölfjähriger inmitten von Fördertürmen und Hochhaussiedlungen. Die Mutter verreist mit der Schwester in die Kur, sie hat‘s an der Galle. Der Vater bekommt keinen Urlaub, und so verbringt Julian seine Tage zwischen Langeweile, kleinen Ausflügen und Begegnungen mit dem frühreifen, drei Jahre älteren Nachbarsmädchen Marusha, die nicht nur Julian den Kopf verdreht.
Rothmann beschreibt diesen Alltag zwischen pubertärem Erwachen und Entdeckerlust mit großer Intensität, dringt tief in die Gefühlswelt eines Zwölfjährigen ein, und zum anderen schildert er die Welt drumherum ebenso realistisch und detailgenau. Ein schöner, intelligenter und menschlicher Roman. In „Feuer brennt nicht“ (2009) ist Kreuzberg, fast zwanzig Jahre nach dem Mauerfall, gesichtslos geworden und so ziehen Alina und Wolf an den grünen Rand der Stadt. Am Müggelsee, wo die Unterschiede zwischen Ost und West noch nicht verwischt sind, dem Ort erstaunlicher Begegnungen mit Menschen aus der untergegangenen Republik, sieht Wolf sich aber zunehmend überfordert von dem alltäglichen Zusammenleben mit Alina, den „Details der Zweisamkeit“, der Enge trotz komfortabler Wohnung.
Und als plötzlich Charlotte auftaucht, eine Geliebte aus der Vergangenheit, ergreift er die Flucht: getarnt als Ausflüge mit seinem Labrador Webster, beginnt er eine Affäre mit ihr. Doch der fremde Parfümduft im Fell des Hundes hält sich, Alina wird skeptisch, und so überwindet Wolf „die Hölle der Verheimlichung“ und ist überrascht: Seine Frau akzeptiert das Verhältnis zu der Anderen nicht nur, sie ermuntert ihn sogar dazu. Es ist ein Roman über das behutsame Zusammenwachsen von Ost und West und eine Chronik des erotischen Begehrens, eine dunkle Liebesgeschichte.
Seit 2001 („Ein Winter unter Hirschen“) veröffentlicht Ralf Rothmann Bücher mit Erzählungen. Zumeist geht es in seinen Geschichten um Menschen aus den „unteren Schichten“, Erzählungen aus der Perspektive derjenigen, die den Veränderungen in ihrer Umwelt hilflos gegenüberstehen. Die Erzählungen leben (wie seine Romane) von Milieuschilderungen, im engeren Sinne vom Ruhrpott, in dem er aufgewachsen ist. Und eine gewisse suggestive Wirkung zeigt sich darin, dass seine Hauptfiguren oft Heranwachsende sind: Da ist die Sprache einfach, da ist die Welt einerseits geheimnisvoll, andererseits noch recht gut überschaubar. Es gibt dabei auch häufig etwas pathetische Passagen, die die Kunst als Gegenwelt feiern, etwas Metaphysik wird hin und wieder zusätzlich aufgerufen – manchmal ist man an Hermann Hesse erinnert, der Ralf Rothmann früh geprägt hat. Geschildert werden dramatische wie auch beglückende Wendepunkte im Leben der jeweiligen Protagonisten, etwa vom Selbstbetrug eines sterbenden Stasi-Beamten, von einer missratenen Orgie an der Ostsee, vom Wiedererwachen einer Liebe in einem japanischen Kloster, vom alternden Dozenten, dem während einer Autopanne in der mexikanischen Wüste die Logik der Liebe aufgeht, der Geigerin, die eine finale Diagnose erhält, oder dem Kind im Treppenflur, das seine Prügelstrafe erwartet
Am erschütterndsten ist wahrscheinlich die Titelgeschichte des Bandes „Hotel der Schlaflosen“ (2020). Erbarmungslos nimmt der Erzähler die Perspektive eines sich im Rückblick weiterhin fanatisch im Recht wähnenden Folterers ein, der das Töten im Akkord verrichtet in einem gekachelten Keller, „wo man kaum nachkam mit dem Ausspritzen“. Der Erzähler hat sich in den Kopf Wassili Blochins hineinversetzt, der als Scherge Stalins tausende Menschen liquidierte, nachweislich 15 000, erwiesenermaßen durch Kopfschuss, nie ohne Schürze. Der Sadist, vertraut mit der Angst und der Panik seiner Opfer, vertraut auch mit „jedem Schädelnerv“, tritt, bevor er sich mit der von ihm verehrten Pistole hinter Isaak Babel stellt, an den in Ungnade gefallenen Autor des Bürgerkriegsromans „Die Reiterarmee“ heran mit einer Bitte. So umschreibt er, indem er dem Verurteilten ein Exemplar seines Buches hinhält, seinen Autogrammwunsch. Dem Mord voraus geht der Vorwurf des Bürokraten, Babel habe „die Realität mit Realismus verwechselt“. Der Henker als Herr über Realität und Realismus. Ein Mensch in den Händen seines Henkers ist ein poröses Wesen. Wie die meisten seiner Erzählungen besticht auch sie mit einer Sprache voll magischer Genauigkeit.
WELTKRIEGS-TRILOGIE
„Ich habe im Verlauf der Jahre die Erfahrung gemacht, dass man sich die wirklich substanzvollen Texte nicht ausdenken kann“, erklärte Ralf Rothmann in einem Interview, denn: „Die entwickeln sich aus einer inneren Notwendigkeit, ja, sie drängen sich oft auf, und wenn man dann demütig genug ist, diesem Impuls zu folgen, gelingt die Arbeit auch. (…) In ‚Im Frühling sterben‘ war es so, dass das beharrliche Schweigen meines Vaters über den Krieg eine Art Vakuum in mir hinterließ, das einen gewissen Sog entwickelte. Ich habe den damals schon verstorbenen Mann sehr geliebt und wollte wissen, was jene Jahre, in denen er unfreiwillig Soldat sein musste, mit ihm gemacht hatten, warum er so tief melancholisch geworden war, und also habe ich versucht, mich in die Zeit einzufühlen. So wie ich es aufschrieb, war es dann vermutlich nicht, aber so könnte es gewesen sein. Jedenfalls habe ich später von vielen Lesern gehört: ‚Jetzt, nach der Lektüre Ihres Buches, kann ich das Schweigen meines Vaters über den Krieg verstehen.‘ Denn es war eine ganze Generation, die bis ins Innerste verstummt und auch traumatisiert war angesichts ihrer Erinnerungen.“
So erzählt Ralf Rothmann in „Im Frühling sterben“ (2015) die Geschichte von Walter Urban und Friedrich („Fiete“) Caroli, zwei 17-jährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 für die Waffen-SS zwangsrekrutiert werden. Nach einer dreiwöchigen Grundausbildung werden sie nach Ungarn an die Front gebracht. Während Fiete an der Front kämpfen muss, wird Walter als Fahrer eingesetzt. Doch auch er erlebt die Gräuel des Krieges, als er beispielsweise die Ermordung dreier Bauern mit ansehen muss. Inzwischen wurde Fiete beim Kampf an der Front verwundet und Walter besucht ihn im Lazarett. Fiete erfährt, dass seine Eltern bei einem Luftangriff auf Hamburg gestorben sind und als Walter hört, dass sein Vater gefallen sei, bittet er um ein paar freie Tage, um dessen Grab zu suchen, das er nicht findet. Nach seiner Rückkehr erfährt er, dass Fiete desertiert ist und versucht vergeblich, das Leben seines Freundes zu retten. Im Gegenteil, er und seine Kameraden sollen Fiete erschießen, was am nächsten Morgen geschieht. Bald darauf gerät Walter in amerikanische Kriegsgefangenschaft und nach seiner Freilassung fährt er in seine Heimatstadt Essen-Borbeck. Der Empfang seiner Mutter fällt sehr kalt aus, und er kehrt zurück nach Norddeutschland. Doch die Arbeit haben mittlerweile Maschinen übernommen. Er macht sich schließlich auf den Weg nach Kiel, seine Jugendfreundin Elisabeth aufzusuchen, die seinen Heiratsantrag annimmt, woraufhin das Paar eine Stelle als Melkerehepaar auf einem Hof in der Nähe antreten kann.
Es geht in diesem großartigen Roman um eine Jugend im Krieg, um das letzte Aufgebot der 17-Jährigen, die mit der SS-Rune auf der Uniformjacke in Hitlers verlorene Schlachten geschickt wurden, um einen Jungen, der seinen besten Freund erschießen, und den Freund, der als Deserteur an der ungarischen Front sterben muss. Und es geht, wie in allen Büchern Rothmanns, um die Familiengeschichte des Autors, auch sein Vater war Melker, stammte aus Essen, kämpfte in Ungarn und kehrte später aus Norddeutschland ins Ruhrgebiet zurück, wo er als Kohlekumpel schuftete. Es ist ein virtuoses Requiem für seinen Vater.
In „Der Gott jenes Sommers“ (2018) wird die Geschichte von „Im Frühling sterben“ weitergesponnen aus der Sicht der zwölfjährigen Luisa, die die letzten Kriegsmonate auf dem Gut ihres regimetreuen Schwagers verbringt – und dort auch dem jungen Walter wieder begegnet und sich in ihn ein bisschen verliebt, ehe der nach Ungarn an die Front geschickt wird. Anfang 1945 muss also Luisa Norff mit ihrer Mutter und der älteren Schwester aus dem bombardierten Kiel aufs Land fliehen, auf das Gut ihres Schwagers Vinzent, eines SS-Offiziers. Während alliierte Bomber ostwärts fliegen und immer mehr Flüchtlinge eintreffen, streift das verträumte Mädchen durch die Wälder und versucht zu verstehen, warum sie so verwirrt ist, wenn sie den jungen Melker Walter sieht, wer die Gefangenen am Klostersee sind, wohin ihre Schwester Billie plötzlich verschwunden ist und von wem die Perückenmacherin eigentlich die Haare bekommt? Und als sie auf einem Fest zu Vinzents Geburtstag vergewaltigt wird (aber nicht, wie stets befürchtet, von einem Russen, sondern von ihrem Schwager Vinzent), erkrankt sie schwer an Typhus und muss für längere Zeit das Bett hüten. Es ist eine erschütternde Geschichte über das Klima von Verblendung und Denunziation in den letzten Monaten eines Krieges, der jedem für immer die Seele verdunkelt und die Zwölfjährige sagen lässt: „Ich hab alles erlebt.“
Mit „Die Nacht unterm Schnee“ (2022) schloss Rothmann seine Trilogie über den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit in Deutschland ab. Hier schrieb er über seine Mutter. Die sehr junge Elisabeth in dem Roman wird in einem Verschlag mehrfach von russischen Soldaten vergewaltigt. Sie überlebt nur, weil ein anderer Russe sie findet und gesund pflegt. Doch sie bleibt ihr ganzes Leben davon schwer gezeichnet. Seine Mutter habe ihm zu dem Thema einst gesagt: „Einer hat mich mal geschnappt in Pommern, und jetzt frag mir kein Loch in den Bauch.“ Damit sei die Sache in der Familie Rothmann erledigt gewesen.
Für seine Mutter sei die Zeit sicherlich traumatisch gewesen, sagte Ralf Rothmann in einem Gespräch: „Es ist so, dass meine Mutter das Vertrauen da hinein, dass das Leben und sie sich annähernd so entwickeln, wie man es vernünftigerweise erwarten könnte, dass dieses Vertrauen völlig zerstört war. (…) Sie hat Gewalt als etwas blitzartiges, als etwas völlig Unbegründetes und Unverdientes erfahren, und das hat sie auch weitergegeben. (…) Diese traumatische Erfahrung, dass Gewalt ohne jeden Grund über einen kommen kann, ohne dass man selbst irgendetwas getan hätte, hab‘ ich selbst auch in meiner Kindheit oft machen müssen.“ Im Ruhrgebiet generell sei es in seiner Kindheit und frühen Jugend sehr gewalttätig zugegangen. Er hat das Buch aus der Perspektive ihrer Freundin, einer erfundenen Freundin, geschrieben und dadurch gelang ihm eine notwendige Distanz.“
Luisa, die Erzählerin, ist inzwischen Bibliothekarin geworden und der Autor überlässt es ihr, der ausgebildeten Leserin, uns das Gerüst seines Romans kurz zu zeigen. Ein Schriftsteller, erklärt Luisa schon ganz am Anfang, „verfügt selten über mehr als seine Biografie, und wenn er redlich ist, präsentiert er den Lesern nichts von dem, was eigentlich jeder erfinden könnte, etwas Originelles womöglich; trostlos klug sind wir schließlich alle. Vielmehr schreibt er, was nur er schreiben kann: seine eigene, von den Echos und Schatten der Vergangenheit und dem Vorschein der Zukunft umschwebte Geschichte. Nur dann wird seine Sprache eindringlich werden und, so paradox das klingen mag, auch andere angehen.“
Zu seinem 70. Geburtstag hat Ralf Rothmann die 36 Notizbücher, die er über beinahe fünfzig Jahre geführt hat, durchgesehen und daraus Texte, die er nicht für seine Bücher verwendet hat, zusammengestellt. Diese Aufzeichnungen sind nun bei Suhrkamp unter dem Titel „Theorie des Regens“ erschienen. Und man kann diese kurzen, mitunter seitenlangen, gelegentlich aphoristisch knappen Texte wie eine poetische und poetologische Autobiografie Ralf Rothmanns lesen, auch als eine Art Einführung in das Werk dieses großen Romanschriftstellers, der das Ruhrgebiet, seine ungeliebte Kindheitsheimat, zu einem poetischen Ort umgeschrieben hat. Es ist eine herbe Poesie, die sich in seinem Erzählton entfaltet, ein Ton, in dem immer eine Spur zum letzten Geheimnis des Erzählens anklingt, zum Unaussprechbaren nämlich. Er habe, so diagnostizierte Rothmann einmal, sehr bald begriffen, dass das Ruhrgebiet eine Gegend ist, in der die Leute „sich den Boden unter den Füßen weg graben, um nach oben zu kommen“.
Foto: (c) Heike Steinweg / Suhrkamp Verlag